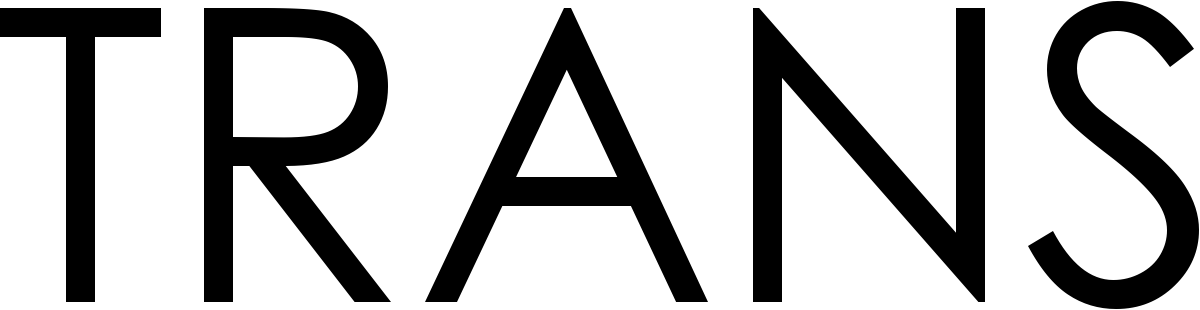Nr. 18 Juni 2011 TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften
Section | Sektion: Städte und Sitten in der Literatur
Die Stadt in Deutschland als Raum der Identitätsfindung –
ein Essay
Gabriele Ziethen (Worms, Deutschland) [BIO]
Email: g.ziethen@aksum-gz.de oder g.ziethen@gmx.de
Konferenzdokumentation | Conference publication
Städtisches Leben in Deutschland, wie es die Gegenwart kennt, ist das Resultat einer langen und komplexen Entwicklung des Landesausbaus, des Siedlungswesens und des Selbstbewußtseins der jeweiligen Bewohnerschaft. Kulturelle Kontinuitäten und Brüche sind anhand einiger Beispiele deutlich erkennbar, doch gehen manche Entwicklungen auch fließend ineinander über: das Leben in und mit der Stadt muß als dynamischer Prozeß wahrgenommen werden.
Die Entwicklung der Stadt als eines sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und administrativen Organismus durchlief im Westen Mitteleuropas unterschiedliche Stufen, die sich sogar innerhalb der Grenzen der heutigen Nationalstaaten – sofern diese nicht in größeren Verwaltungseinheiten aufzugehen beginnen, z.B. der Europäischen Union und ihrer Metropolregionen – z.T. deutlich voneinander unterscheiden (z.B. in Deutschland und Frankreich durch die unterschiedliche Weiterentwicklung des römischen Städtewesens in den nachantiken Jahrhunderten).
Die prähistorische Welt des westlichen Mitteleuropa schuf mit den spätkeltischen oppida Siedlungsstrukturen, deren administrative und ökonomische Zusammenhänge (z.B. Wehrhaftigkeit) durch die archäologische Forschung sichtbar gemacht werden können. Diese oppida traten erst spät in die Vorphase der Stadtstaatengründung (ähnlich dem Vorbild der mediterranen poleis) ein, gerieten aber gleichzeitig in den ökonomischen und militärischen Fokus der römischen Expansionspolitik, weshalb diese keltischen oppida ihren Siedlungscharakter nicht mehr über einen längeren Zeitraum unabhängig entwickeln konnten. Das keltische Siedlungswesen nördlich der Alpen, und besonders Gallia in seinen geographisch bis zum Rhein reichenden Grenzen, wurde infolge der Aktivitäten des Gaius Iulius Caesar ab der Mitte des 1. Jhs. v. Chr. in die auf die Schaffung einer Rheingrenze ausgerichtete Politik des Kaisers Augustus einbezogen: das Gebiet war seit dem letzten Jahrzehnt des ausgehenden 1. Jhs. v. Chr. durch die Schaffung des römischen Provinzwesens geopolitisch von Rom abhängig. Diese Kohärenz wurde während des Mittelalters infolge der Wahlmodalitäten der deutschen Kaiser und Könige fortgesetzt. Hier trat besonders das Erzbistum Köln in den Vordergrund, dessen Bischof bei den Kaiserwahlen den größten Einfluß geltend machen konnte.
Für die Weiterentwicklung der vorrömischen Siedlugungen bedeutete die römische Präsenz einerseits den teilweisen Abbruch des Siedlungswesens, andererseits den Beginn römischer Neusiedlungen, die im Laufe des 1. Jh s. n. Chr. auch Träger des römischen Verwaltungswesens wurden, welches wiederum Ausdruck der römischen Provinzbildung war, deren Gestaltung mit einigen rechtsrheinischen Ausnahmen im Limeshinterland jedoch meistens linksrheinisch orientiert war. Diese Phase wurde zum Ende des 1. Jhs. n. Chr. weitestgehend abgeschlossen . Die römisch geprägten Neusiedlungen waren entweder an die Existenz römischer Militärlager gebunden (z. B. Xanten, Köln, Bonn, Mainz, Straßburg, Regensburg, Augsburg) und orientierten sich an den Grenzflüssen Rhein und Donau. Aus diesen größeren Ansiedlungen gingen die heutigen Großstädte hervor, deren römischer Ursprung auch heute noch in den Stadtnamen sichtbar ist. Die römischen Städte konnten als Ansiedlung römischer Veteranen, zugewanderter Händler aus dem Mittelmeerraum oder eingebürgter einheimischer Ethnien (Kelten, Germanen) den Status einer colonia erhalten (z.B. aus Colonia Claudia Ara Agrippinensium wurde später Köln), oder als civitas gegliedert sein als einer auf den Ausbau autonomer Verwaltung innerhalb der Provinz ausgerichteten Zentralsiedlung, die über ein administrativ abhängiges Hinterland verfügte (z.B. die civitas Taunensium, zu der Mainz, Wiesbaden und die ländlichen Siedlungen im Gebiet des heutigen Frankfurt gehörten). Des weiteren gab es municipia, die man am ehesten als Landstädtchen verstehen kann, und schließlich die zahlreichen vici: an den römischen Landstraßen gelegen, verkörpern diese meist auf handwerkliche Produktion ausgelegten Siedlungen, das Leben der „kleinen Leute“.
Das agrarisch geprägte Wirtschaftsleben und somit auch die ökonomische Rundumversorgung der Großsiedlungen wurde durch die villae rusticae gewährleistet: zumeist ummauerte Gutsbetriebe in Einzellage, deren Eigentümer entweder im Provinzgebiet gebliebene römische Veteranen, zugewanderte Italiker oder den römischen Lebensformen zugewandte Einheimische der jüngeren Generation waren. Diese landwirtschaftlichen Gutsbetriebe produzierten für die Versorgung der Militärlager, für die Beschickung der lokalen Märkte und den Eigenbedarf. Damit wurde das neue Gebiet der Provinzen auf ein Wirtschaftssystem römischen Zuschnitts und römischen Rechts umgestaltet.
Die Phase der römisch geprägten Aufsiedlung kann im wesentlichen im 2. Jh. n. Chr. als abgeschlossen betrachtet werden. Dieser Entwicklung entspricht auch die Angleichung des Rechtsstatus von Alt- und Neubürgern zu Beginn des 3. Jhs. n. Chr. durch Kaiser Caracalla. Erste Veränderungen sind ab der Mitte des 3. Jhs. n. Chr. zu beobachten (Aufgabe der Limesgrenze, Zurückverlegung der römischen Verteidigungslinie auf die linksrheinischen Gebiete, allmähliche Ansiedlung germanischer Foederaten).
Mit dem Beginn der Migration elbgermanischer Ethnien (z. B. Alamannen) ab dem 3. Jh. n. Chr. und vor allem im 4./5. Jh. n. Chr. auch rechtsrheinischer und niederrheinischer germanischer Ethnien (z.B. Franken) erhalten die Großsiedlungen des römischen Reichsgebietes erstmals im 4. Jh. n. Chr. Befestigungen (Ummauerungen), die sich oft bis heute im Verlaufsbild vieler mittelalterlicher Stadtmauern widerspiegeln (z.B. Köln, Mainz). Gleichzeitig fand in einigen Gebieten der Rückzug der lateinisch sprechenden Bevölkerung in schwer zugängliche Höhensiedlungen statt (z.B. im Moseltal) statt, aus denen jedoch keine bis in unsere Zeit nachweisbare Siedlungskontinuität hervorging.
Die Siedlungsentwicklung ab dem 4./5. Jh. n. Chr. war bestimmt durch die Entstehung fränkischer und alamannischer Neusiedelgebiete (vgl. die fränkischen „heim“-Orte und die alamannischen „ingen“-Orte), welche sich, meist an kleinen Gewässern gelegen, zwischen die spätrömischen villae rusticae, civitates und übrigen Sieldungsstrukturen schoben, deren ökonomischer Funktionszusammenhang letztendlich meist in den nachfolgenden Jahrhunderten zugrunde ging. Vornehmlich in den römischen Weinbaugebieten konnten sich noch mehrere Jahrhunderte (ungefähr bis in ottonische Zeit) lateinisch geprägte Sprachinseln erhalten.
Am typischsten erhielt sich indessen die römische Verwaltungstradition in denjenigen der ehemaligen coloniae oder civitates, die früh Bischofssitz geworden waren und mit ihrer Diözeseneinteilung weitgehend die spätantiken römischen provinzialen Verwaltungsgrenzen zeigen (z.B. Trier, Köln, Mainz, Regensburg, Augsburg).
Für den früh- und hochmittelalterlichen Landesausbau – nunmehr vom germanischen Kulturelement geprägt – ist die Gebietssicherung durch Burgenbau (z.B. im Rheingebiet) charakteristisch.
Die Veränderung der Zentren in den ehemaligen römischen Großsiedlungen ist daran erkennbar, daß der zentrale öffentliche Bereich um das ehemalige forum durch eine auf die zentral gelegene christliche Kirche/Bischofskirche (oft durch Überbauung eines antiken Heiligtums oder Verwaltungssitzes) oder den bewehrten Wohnturm bzw. die Wohnburg eines Adeligen bezogene Baustruktur charakterisiert ist. Der Weg in die typische Stadt des Mittelalters war beschritten.
Im rechtsrheinischen Gebiet erfolgte der frühmittelalterliche Landesausbau mittels Gründung von Missions- und Pilgerzentren (z.B. Fulda), was nicht selten mit einer gewaltsamen Missionstätigkeit und Platzbehauptung verbunden war, sowie durch den Ausbau königlicher Pfalzen (z.B. Aachen, Paderborn, Goslar, Ingelheim). Da das merowingisch-karolingische Königtum und auch hochmittelalterliche Kaisertum als „Reise-Monarchie“ nicht an feste Verwaltungssitze gebunden war – im Gegensatz zur ehemaligen römischen Verwaltungspraxis – wurde die Stadt eher als Bischofssitz wahrgenommen (hier wurde von den Klerikern Latein gesprochen), was ihr gegenüber der mobilen Herrschaftsausübung der weltlichen Funktionsträger in der Ausbildung eines Identitätsgefühls einen wesentlichen Vorteil verschaffte.
Da die Städte andererseits – bzw. die in ihnen angesiedelten Stände und Berufsgruppen – vielfach Privilegien seitens der weltlichen Landesfürsten genossen, wurde der Zuzug in die Stadt attraktiv: „Stadtluft macht frei“ – eine in der sozialen Welt schollengebundener Feudal- und Agrarwirtschaft einmalige Möglichkeit zur Verbesserung der persönlichen Lebensumstände. Das daraus hervorgegangene frühe städtische bürgerliche Bewußtsein schärfte seine Identität weniger in der Auseinandersetzung mit den weltlichen Landesherren, als vielmehr in der Behauptung der Privilegien gegenüber der Kirche, was im Fall der Personalunion von weltlicher und geistlicher Gebiets- oder Stadtherrschaft besonders schwierig war. Aus diesen jahrhundertelangen Bemühungen um bürgerliche Selbstbestimmung (vgl. den Rheinischen Städtebund 1254-1257, dem ca. 70 Städte angehörten) entwickelte sich letztendlich das bis in unsere Zeit existierende bürgerliche Selbstbewußtsein, das in einigen Städten auch mit der kirchlichen Feststruktur der christlich umgewidmeten spätantiken Traditionen verbunden blieb: in den katholischen Städten am Rhein sind dies Karneval und Fastnacht. Im Südwesten des heutigen Deutschlands bildete sich hingegen eine alemannisch geprägte Identität heraus, deren „gefühltes Zentrum“ heute auf Schweizer Staatsgebiet liegt: die durch den früheren Tuchhandel berühmt gewordene Klosterstadt Sankt Gallen, von deren Kloster die berühmte zweite Missionsphase in karolingischer Zeit ab dem 8. Jh. in die rechtsrheinischen Gebiete getragen wurde.
Im Norden ist eine teilweise vom Süden verschiedene Entwicklung zu beobachten, da die dortigen heutigen Großstädte nicht auf römische Siedlungstraditionen zurückgehen. In Hamburg und Bremen erfolgte trotz früher Bischofsherrschaft der Ausbau des Seehandels, was im Laufe des 12. und 13. Jhs. zu einem schnellen Erstarken der im Handel tätigen bürgerlichen Berufsgruppen beitrug (Kaufleute, Kontorbesitzer, Reeder, Kapitäne): der Hanse unter Führung der Stadt Lübeck, wo auch bis zum 17. Jh. Tagungen des Hansetages stattfanden. Diese Tradition manifestiert sich noch in unserer Zeit in zwei berühmten Festveranstaltungen, die beide einem strengen Protokoll unterliegen: der Bremer Schaffer-Mahlzeit und dem Matjesessen der Hamburger Kaufmannschaft. Zu beiden Veranstaltungen (in Bremen seit 1974 auch ein Schafferinnen-Mahl) werden auswärtige Gäste aus den Bereichen Handel, Wissenschaft, Politik nur nach sorgfältigster vorheriger Auswahl und nur einmal im Leben eingeladen.
In Schleswig-Holstein wurde der mittelalterliche Siedlungs- und Landesausbau vielfach an die ethnischen Grenzen der germanischen und slawischen Sieldungsgebiete geknüpft. Aus der Wikingersiedlung Haithabu, die ökonomisch und ethnisch den gesamten Ostseeraum repräsentierte, ging die heutige Stadt Schleswig hervor. Lübecks Einfluß als führende Hansestadt auf seine östlich gelegenen Nachbarstädte, u.a. auf Rostock in Mecklenburg-Vorpommern (der Wortbestandteil „Pommern“ geht auf slawische Sprachwurzeln zurück und bedeutet „am Meer gelegen“) und auf die Gebiete des Deutschen Ordens nahm zu. Thomas Mann hat 1901 mit seinem Roman „Die Buddenbrocks“ der Kaufmannstradition Lübecks ein weltberühmtes literarisches Denkmal gesetzt.
Die Städtelandschaft Ostdeutschlands (im geographischen Kontext nach 1945) bis zur Oder-Grenze (die durch mittelalterliche Kreuzzüge okkupierten und im Zweiten Weltkrieg verlorenen Gebiete des ehemaligen Ostpreußen werden hier nicht betrachtet, da sie in ihrer kulturgeschichtlichen Genese unterschiedliche Traditionen im Vergleich zum germanisch-slawischen Altsiedelgebiet der Elb-Havel-Linie haben, sondern eher den baltisch-slawischen Kulturen angehören) ist weitgehend geprägt von der sog. frühdeutschen Aufsiedlung des ursprünglich germanisch-slawischen Grenzgebietes oder slawischen Siedlungsgebietes. Der komplexe Vorgang ist als Fortsetzung der fränkischen Ostexpansion des frühen Mittelalters zu verstehen. Diese wurde von einer Veränderung der territorialen und sprachlichen Situation im slawischen Siedlungsgebiet begleitet, wie sich anhand der heute noch existierenden slawischen (im Sammelbegriff wendischen) Orts- und Familiennamen oder Namensbestandteilen ablesen läßt, z.B. den eingedeutschten Namen in Mecklenburg-Vorpommern, dem brandenburgischen Havelland, also den Gebieten zwischen Elbe, Havel und Oder.
Eine eigene kulturelle und sprachliche Identität haben sich die slawischen Sorben in und um Bautzen, Hoyerswerda und im Spreewald bewahrt, deren Sprache zu den offiziellen Minderheitensprachen in der Bundesrepublik Deutschland gehört (zusammen mit Dänisch und Friesisch).
Somit leitet sich die „Sonderstellung“ Berlins, bzw. die sog. Berliner Identität, in Abgrenzung zu allen übrigen Städten Deutschlands von der Randlage in Bezug auf den Kern des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Reichsgebietes, der Umwandlung der Altslawischen Burganlage bei Spandau zu einer neuen, deutschen Siedlung und dem Zuzug von Siedlern aus Westeuropa (im 17./18. Jh. religiös Verfolgte, Fachleute im Bereich Wasserbau) ab. Die Tatsache, daß auch die politische Identität des „Deutschseins“ erst eine relativ junge Erscheinung ist, die im 19. Jh. im Rahmen der Entstehung des Nationalstaates gefestigt wurde, macht die somit auch junge preußische Residenz seit der Zeit Friedrichs II. d. Gr. von Hohenzollern zum Ausgangs der Entstehung neuer politischer Mythen.
Nachdem Gerhard Hauptmann in seinem Bühnenstück „Die Ratten“ 1911 die sozialen Probleme der kaiserlichen Großstadt wilhelminischer Prägung bildhaft schilderte und Alfred Döblin 1929 mit seinem Roman „Berlin Alexanderplatz“ nicht nur der Stadt selbst, sondern einem ihrer als charakteristisch empfundenen Plätze ein schonungsloses literarisches Denkmal des Jahrzehnts nach dem Ersten Weltkrieg setzte, beschleunigte die Teilung Berlins nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur die politische, sondern auch die künstlerische Mythenbildung. Während im Stadtzentrum die Wiedernutzung des ehemaligen Bendler-Blocks – dem Ort der Hinrichtung Graf Schenk von Stauffenbergs und anderer Teilnehmer des Widerstandes gegen Adolf Hitler 1944 – jetzt durch die Ansiedlung der Gedenkstätte des Deutschen Widerstandes und eines Bundesministeriums zwiespältige Gefühle weckt, sind auch noch zwanzig Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung von 1989/90 Schlager wie „Über den Dächern der großen Stadt“ oder „Ich hab’ noch einen Koffer in Berlin“ bekannt und wecken Sehnsüchte, die in die Vergangenheit zurückprojiziert werden.
Welche Faktoren schaffen nun ein städtisches Identitätsgefühl im Deutschland des beginnenden 21. Jahrhunderts?
In den Städten des Rheingebietes ist die katholische Festkultur identitätsbildend, der im profanen Bereich die Legion der „Römer-„ und „Mittelalterfeste“ folgt. Im Süden Deutschlands sind vornehmlich die stark ausgeprägten regionalen Bezüge zu nennen: z.B. München in bezug zum bayrischen Umland, Stuttgart in bezug zur Schwäbischen Alb, in Freiburg die Identität Badens in Konkurrenz zum östlich des Schwarzwaldes gelegenen Schwaben.
Im Norden Deutschlands wird auf Stadt- und Landesebene durch die Schützengilden und -vereine mit ihrer entsprechenden Festkultur Identität gestiftet: als Ausdruck des Willens und der Fähigkeit zu bürgerlicher Selbstverteidigung begehen sei ihre Feste und musikalisch umrahmten Umzüge nach genau festgelegten Abläufen.
Die Städte im westlichen Niederrheingebiet, bes. im Rhein-Ruhrgebiet beziehen ihre Identität aus der Tradition des Bergbaus und der noch jungen Großindustrie (vgl. der Beitrag Essens zum Jahr der Europäischen Kulturhauptstadt 2010). Besonders im Rhein-Ruhr-Gebiet – das kulturell und historisch in großen Teilen zu den alten Niederlanden des 17. Jhs. bis in die Zeit vor dem Wiener Kongreß (1814–1815) gehört – werden seit einiger Zeit die Bestrebungen zu einem Zusammenschluß mit den benachbarten belgischen Wirtschaftsräumen intensiviert: die Schaffung von Metropolregionen im Rahmen der Gebietsneustrukturierungen innerhalb der Europäischen Union beginnt die Grenzstrukturen und die Zugehörigkeit zur föderalen Struktur der Bundesrepublik Deutschland aufzulösen.
Zu den Vorbildern dieser Entwicklung gehört u.a. die Schaffung von länderübergreifenden Kulturparks, wie z.B. des archäologischen Parks Bliesbrück im Saarland, dessen Territorium die Staatsgrenze zwischen Deutschland und Frankreich überdeckt und somit die alte römische Gebietszugehörigkeit wiederherstellt.
Ähnliche Entwicklungen finden in der Metropolregion Rhein-Main-Neckar statt. Mannheim, zum Bundesland Baden-Württemberg gehörend und zusammen mit Duisburg am Niederrhein einen der größten Binnenhäfen Europas stellend, wird zügig zum Zentrum der neuen Metropolregion ausgestaltet und bildet bereits in der Universitätskooperation mit Heidelberg ein neues wissenschaftliches und technologisches Zentrum, von dem große Strahlkraft auf die gesamte Region ausgeht. Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen sind die bevorzugten Studienorte der jungen Generation mit Migrationshintergrund. Die Universitäten in den Landeshauptstädten der Bundesländer stehen nicht mehr in der herkömmlichen Weise im Mittelpunkt bei der Bevorzugung von Studienplätzen, was sich auch in deren Angleichung an die ortsansässigen Fachhochschulen abbildet. Die junge Generation der Studenten entlang des Rheins „stimmt mit den Füßen ab“ und fühlt sich in ihrer Identität zunehmend weniger an die herkömmlichen Strukturen gebunden.
Indessen findet der Osten Deutschlands in seinem städtischen Identitätsgefühl nach dem Ende des Sozialismus und nach zwanzig Jahren deutscher Wiedervereinigung nur langsam zu seinen ehemaligen bürgerlichen Wurzeln zurück. Diese werden neuerdings in der bürgerlichen Selbstentfaltung der postfrederizianischen Zeit und der Zeit der preußischen Reformen zu Beginn des 19. Jahrhunderts gesucht (vgl. die Stadtrenovierungsprojekte in Neuruppin). Deutlich wird dies auch daran, daß mehrere Städte – ehemalige Residenzen des preußischen Königshauses und seiner Verwandten – eigene Ausstellungen zum Luisenjahr 2010 gestalteten: Neustrelitz, Paretz, Berlin-Charlottenburg ehren ihre schöne und frühverstorbene Königin Luise, die den Mut aufgebracht hatte, persönlich mit Napoleon um die Zukunft Preußens zu verhandeln.
Aufgrund der Neigung zu historischen Identitätszitaten sticht Berlin bis heute so frisch und ungewöhnlich gegenüber anderen städtischen Identitäten hervor. Berlin ist experimentierfreudig, dort sind Kultur- und Lebensformen möglich, die z.B. in der alten Universitätsstadt Heidelberg deplaziert wirken würden.
Die Berliner Fashionweek setzt international weit beachtete Akzente für eine Generation, deren Lebens- und Arbeitsweise mobil, wenig ortsgebunden, in Bezug auf die Zukunft aber auch unsicherer geworden ist.
Die „Stadt“ in Deutschland ist ein Ort vielfältiger individueller Möglichkeiten, der Dienstleistungen, des Konsums, aber auch der Ort, dessen Gefährdungspotential im schnellen sozialen Absturz liegen kann.
Die größte Einigkeit hinsichtlich der Identitätsbindung an eine Stadt dürfte in Deutschland darin bestehen, daß der bürgerliche Stolz auf die Leistung des Wiederaufbaus nach den immensen Zerstörungen während des Zweiten Weltkrieges weitgehend noch ungebrochen ist. Dieser Wille zur Aufbauleistung kommt auch bei den zahlreichen Projekten denkmalpflegerischer Stadtsanierungsprogramme zum Ausdruck. Allerdings schwindet in der breiten Öffentlichkeit das solide Grundwissen und z.T. auch das Interesse an der Geschichte „ihrer“ Stadt.
Die identitätsstiftende Erinnerung beginnt angesichts des steigenden Anteils von Menschen mit Migrationshintergrund, die keinen Bezug zu dieser spezifischen Verantwortungs- und Erinnerungskultur in ihrer neuen Heimat entwickelt haben, ebenso wie in den industriegeprägten Großstädten mit ihrer sich wandelnden Arbeitsplatzstruktur zu verblassen. – Das historisch Spezifische beginnt der ökonomisch orientierten Verallgemeinerung zu weichen.
Inhalt | Table of Contents Nr. 18
For quotation purposes:
Gabriele Ziethen: Die Stadt in Deutschland als Raum der Identitätsfindung –
In: TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. No. 18/2011.
WWW: http://www.inst.at/trans/18Nr/II-4/ziethen18.htm
Webmeister: Gerald Mach last change: 2011-07-13