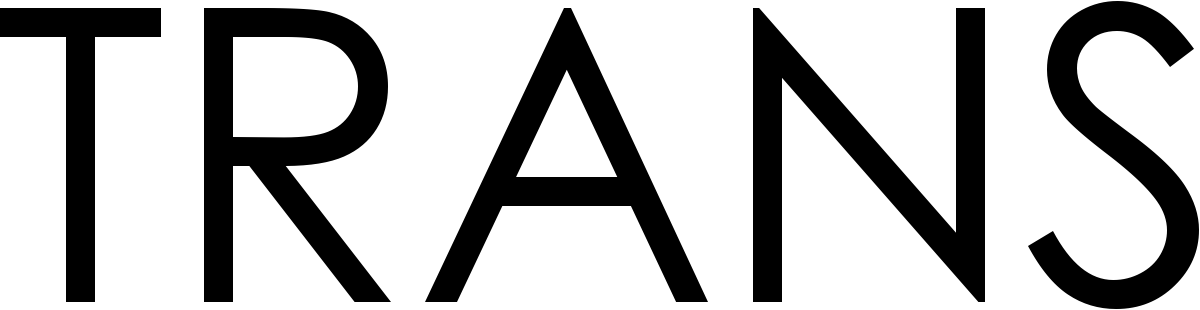TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften 18. Nr. Juni 2011
Plenarbeiträge | Plenary contributions
Hartmut Cellbrot (Herford, Deutschland) [BIO]
Email: Hartmut.Cellbrot@gmx.de
Anspruch und Antwort in Stadterfahrungen
am Beispiel von Musil und Rolf Dieter Brinkmann
Konferenzdokumentation | Conference publication
Künstlerisch gestaltete Großstadterfahrungen können als paradigmatisch für den europäischen Modernismus angesehen werden, insofern sie auf Ansprüche antworten, denen sich der Erfahrende ausgesetzt sieht, ohne dass vorgegebene Ordnungszusammenhänge diese abzudecken vermögen, was die Literaturwissenschaft dazu herausfordert, bei der Ausbildung ihrer Kategorien dem Rechnung zu tragen.
Kennzeichnend für derartige Ansprüche, die vorhandene Deutungsmuster übersteigen, ist es, dass sie einen treffen, anrühren, erstaunen, ihnen mithin ein gewisser Überwältigungscharakter eignet. In diesem Sinne kann man auch von einem Widerfahrnis(1) sprechen; das ist etwas, das uns zustößt. Das unvermutet Zustoßende, das Benjamin als „Schock“ und Georg Simmel als „Reizüberflutung“ bezeichnet haben, geht jeder Darstellung voraus.
Infolge einer solchen Überforderung werden zugleich Habitualitäten aufgelöst und veränderte Wahrnehmungseinstellungen ermöglicht. So entsteht Raum für ihren Neuaufbau. Exemplarisch widerfährt es Rilkes Malte Laurids Brigge, der in sein Tagebuch notiert: „Ich lerne sehen.“(2) Im Wahrnehmungsfeld der Großstadt wie im Text vermag alles Gegebene in einen Strudel zu geraten, dem man sich entweder aussetzt oder durch abstrahierende Reflexionen entzieht. Er wird als ein Anspruch erfahren, dem eine gewandelte Form der Wahrnehmung antwortet, die in die Lage versetzt, das Gesehene neu zu strukturieren. In der Unterbrechung des Normalblicks sieht man von den einzelnen Dingen im Bewegungsablauf ab, sie werden als Elemente eines Flusses erlebt.(3) Die Reduktion des Normalblicks lässt die Dingkonturen verschwimmen, und dieser Prozess veranlasst die Suche nach neuen Einstellungen sowie deren künstlerischen Äquivalenten. Der künstlerische Blick entdeckt durch die alltäglichen Formen hindurch abstrakte Konfigurationen, die allerdings nicht wertneutral sind, vielmehr zugleich eine Deutung einschließen.(4) Ein prominentes Beispiel zu diesem Sachverhalt stellt die Beschreibung des Großstadtverkehrs in der Eingangspassage von Robert Musils „Der Mann ohne Eigenschaften“ vor: „Fußgängerdunkelheit bildete wolkige Schnüre. Wo kräftigere Striche der Geschwindigkeit quer durch ihre lockere Eile fuhren, verdickten sie sich, rieselten nachher rascher und hatten nach wenigen Schwingungen wieder ihren gleichmäßigen Puls.“(5) Die Anonymisierung des Menschen und die damit einhergehende Verdinglichung menschlicher Verhaltensweisen ist vornehmlich zu einem Topos der expressionistischen Lyrik geworden. Zu denken wäre nur an Paul Boldts Gedicht „Café Josty“, wo zu lesen ist: „Die Menschen rinnen über den Asphalt, /…/ Schwimmen wie Sonnenlicht durch dunklen Wald.“(6)
Wie das Antworten auf Ansprüche thematisch wird, vermag eine Szene aus dem Eingangskapitel des „Mann ohne Eigenschaften“ zu veranschaulichen, in der ein Herr und eine Dame, die sich auf einem Spaziergang in Wien befinden, Zeugen eines Verkehrsunfalls werden. Plötzlich war „etwas aus der Reihe gesprungen“, schreibt der Erzähler, „ein schwerer, jäh gebremster Lastwagen“(7). Ein Vorfall wird geschildert, der für einen Augenblick vorgegebene Ordnungszusammenhänge wie Vorzeichnungen der Erfahrung unterbricht. Vorübergehend verlieren die Passanten das Gleichgewicht ihrer normalstimmigen Orientierung: Etwas springt aus der Reihe, ihnen ist etwas widerfahren, das sie zur Deutung herausfordert. Zwischen Erleben und Deutung tut sich ein Spalt auf; die Passanten sind hilflos. „Wie die Bienen um das Flugloch hatten sich im Nu Menschen um einen kleinen Fleck angesetzt, den sie in ihrer Mitte freiließen.“ Sie richteten ihre Blicke „in die Tiefe des Lochs“(8), wo man den Verletzten auf den Boden gebettet hatte. Das unerwartete Geschehen fordert die Dame zu einer Stellungnahme heraus; zunächst ist sie ratlos, ein „lähmendes Gefühl“ bemächtigt sich ihrer, sie empfindet etwas „Unangenehmes in der Herz- Magengrube“, nur für einen kurzen Moment bleibt dieser Spalt des Unverständnisses sichtbar, alsbald erfolgt die Deutung. Denn als ihr Begleiter den „zu langen Bremsweg des Lastwagens“ als Erklärung anbietet, legt sich ihre anfängliche Verwirrung. Erleichtert greift sie den knappen Hinweis auf und gibt sich damit zufrieden; „es genügte ihr“, kommentiert der Erzähler, „daß damit dieser gräßliche Vorfall in irgendeine Ordnung zu bringen war“. Der Dame wird daher allein „das „unberechtigte Gefühl“ zugestanden, „etwas Besonderes erlebt zu haben.“(9) Eine Normalisierung des singulären Ereignisses stellt sich ein, d. h. es wird als etwas Gesetzhaftes, wenn auch nur nach statistischen Gesetzen, in die Erfahrung eingereiht. Die Normalisierung bedeutet zugleich die Aufhebung des Besonderen, Einmaligen; es wird zu „Seinesgleichen geschieht“(10), zu etwas, das auf ähnliche Weise alle Tage stattfindet und von dem man nicht weiß, ob es selbst stattfindet oder am Ende bloß etwas Stellvertretendes.(11) Den Erfahrungsanspruch, den der Verkehrsunfall erhebt, wird durch die Normalisierung, d. h. Eingliederung des Vorfalls in einen gesetzmäßigen Vorgang beantwortet, wodurch sich die Differenz zwischen Erleben und Erfassen schließt. Was Musil hier in dieser eher unspektakulären Großstadtszene vorführt, weist auf das große Thema des Romans, auf das Seinesgleichen geschieht als Merkmal der modernen Welt – vergleichbar mit dem Heideggerschen Existenzial des Man, das die alltägliche Seinsweise des Daseins bezeichnet, deren Selbstsein sich durch die Übernahme der Stellungnahmen der „Anderen“(12) herausgebildet hat. Infolgedessen ist das „Man“ das „Niemand, dem alles Dasein im Untereinandersein sich je schon ausgeliefert hat.“(13) Sichtbar wird eine Grundverfassung des Menschen in der modernen Massengesellschaft.
Musils Schreiben gilt einerseits dem unermüdlichen Aufspüren der Welt des Seinesgleichen in ihren unterschiedlichen Erscheinungsweisen, seien es Regeln moralischer Art, wissenschaftliche Diskurse, Ideologien, theologische Systeme, Gefühls- oder Denkordnungen, andererseits der Ausrichtung auf das Singuläre, das sich der Erzählbarkeit zu entziehen trachtet, auf das, was er die „wirkliche Wirklichkeit“(14) nennt. Da für ihn die Frage nach der Wirklichkeit nicht unabhängig von der nach den Konstitutionsbedingungen von Subjektivität zu erheben ist, gerät die temporale Differenz von „Erleben und Erfassen“(15), mithin von Anspruch und Antwort mit in den Blick.
Die beiden Pole des Seinesgleichen geschieht und des Singulären der wirklichen Wirklichkeit bilden auf ähnliche Weise auch das Spannungsfeld, in dem sich die Dichtung eines anderen, scheinbar von Musil thematisch weit abliegenden Autors ansiedeln lässt. Die Rede ist von Rolf Dieter Brinkmann. Über seinem Werk könnte ebenfalls die Überschrift stehen: Seinesgleichen geschieht oder die Suche nach der wirklichen Wirklichkeit. Da bei ihm allerdings das Augenmerk zumindest in den Anfangsphasen weniger auf das Konstruktive der Wirklichkeit gerichtet wird, als vielmehr auf die heterogenen Erscheinungsweisen des öffentlich Ausgelegten, sei es in medialer, kultureller, poetischer, politischer wie wirtschaftlicher Hinsicht, fokussiert sich sein Schreiben von Beginn an auf die Dekonstruktion habitualisierter Wahrnehmungen. Zivilisation sieht Brinkmann als einen unaufhörlichen Prozess unpersönlicher Kräfte, die das Ich- und Weltbewusstsein durchdringen und es gleichsam in seinem In-der-Zeit-Sein sinnbildend mit sich ziehen. Der Satz „die Dinge machen weiter“(16) verleiht dieser Erkenntnis in kondensierter Form Ausdruck. Wenn Brinkmann auch der lange Atem der Reflexion nicht in dem Maße wie Musil gegeben war, so verbindet beide doch der Gestus der Unterbrechung alles Formelhaften im Wahrnehmen, Denken und Fühlen. Ein nicht unerheblicher Unterschied in den Denkvoraussetzungen beider Autoren scheint indes bestehen zu bleiben, der hier nur angedeutet werden kann. Während es Brinkmann um die Freilegung des adäquaten Zugangs zur Wirklichkeit geht, deren Sein vorausgesetzt wird, unterzieht Musil das Wirklichsein selbst einer Kritik, was der Funktion geschuldet ist, die er dem Möglichkeitsdenken zuweist. Der Möglichkeitssinn hat es mit dem Sein-Können zu tun. Brinkmanns Insistieren auf dem Erfassen des unmittelbar sinnlich Gegebenen zielt auf das ab, was ist. Was aber ist, vermag man letztlich nur mit den Sinnen zu erleben. Die Sinne allein verschaffen eine unmittelbare Verbindung mit der Gegenwart. Die an den Körper geknüpfte Sinnlichkeit verleiht dem Ich Wirklichkeit, wie es Wirklichkeit empfängt. Die Aporien, in die er als Autor dadurch gerät und mit denen er sich bis zuletzt abmüht, seien nur erwähnt.
Brinkmanns berühmte Bestimmung von Literatur als dem „Film in Worten“ leitet sich von der Grundvorstellung, Wirklichsein als Gegenwart, mithin Sein als Präsenz zu denken, her. Gleichwohl ist es bemerkenswert, dass er diese poetologische Richtlinie faktisch in den Texten zunehmend unterläuft. Die Definition „Film in Worten“ – das Gedicht montiert konkrete Ausschnitte der alltäglichen Umwelt zu einer „Momentaufnahme“(17) des Hier und Jetzt, wozu Verfahren der „Blitzlichtaufnahme“(18), des „Zooms auf winzige, banale Gegenstände“, „Doppelbelichtungen“ „Schwenks (Gedankenschwenks)“(19) zählen, – ist als Antwort auf Ansprüche zu begreifen, die aus der besagten Erfahrung, „die Dinge machen weiter“, resultieren – mit dem wichtigen Zusatz: ohne Beteiligung des Subjekts. Mit der poetologisch zu verstehenden Kamera-Metapher soll, neben der skizzierten Betonung der Präsenz, die Ausschaltung des kulturell geprägten subjektiven Faktors betont werden. Die Intention, möglichst ungefiltert zu den Sachen selbst vorzustoßen, löst indes einen gegenläufigen Prozess des zunehmenden Fragwürdigwerdens des Gesehenen bzw. des im Gedicht zu Beschreibenden aus. In dem Satz Mauthners „Jeder Gegenstand / ist eine Frage“(20), den Brinkmann in dem Gedicht „Eine Komposition, für M.“ zustimmend zitiert, kommt diese Gegenbewegung als Sprachkritik zum Ausdruck, womit allerdings das Ich wieder als Mitspieler in Erscheinung tritt. Die mit der Sprachkritik einhergehende Subjektkritik erfährt Brinkmann als einen „Kampf“: Der „Kampf um das eigene Bewußtsein geht darum, inwieweit die Barrieren der Wörter durchbrochen werden können, und damit die in Sprache fixierten Sinnzusammenhänge, bis in die eigene Vergangenheit zurück.“(21) Das Fragwürdigwerden der Dinge erfasst oder präziser: umfasst somit das Wahrgenommene wie das wahrnehmende Ich, es verlangt nach Antworten, ohne dass diese je zur Ruhe kämen. Beide Bewegungen – zum einen möglichst voraussetzungslos zu den Sachen selbst vorzudringen, zum anderen die Erkenntnis, dass mit zunehmender Annäherung der Widerstand der Sprache wächst – bilden ein Spannungsgefüge, welches das Gedichtfeld, in dem Ich und Welt vorgängig verflochten sind, prägt. Sinnfällig wird dies in den sogenannten Flächengedichten, vor allem in dem Text „Westwärts“ aus dem postum 1975 erschienen Gedichtband „Westwärts 1&2“. Besonders der 2. Teil vermag als Stadtsondierungsprojekt gelesen zu werden, wobei allerdings auf radikale Weise gewöhnliche topographische und chronologische Orientierungen aufgehoben werden, so dass das kaum Fixierbare der Stadtansprüche erfahrbar wird. Sie werden als Widerfahrnisse erlebt, die Stellungnahmen provozieren, die wiederum das schmerzliche Bewusstsein einer Kluft offenbar machen, die sich aufgrund der Differenz von Erleben und Erfassen auftut. Dass das Antworten prinzipiell stets nachträglich erfolgt, zeitigt den eigentümlichen Umstand, dass der Angesprochene sich selbst der Antwort vorausgeht. Dieses wiederum hat ein Auseinandertreten der Erfahrung zur Folge, wodurch das Ich sich selbst immer schon voraus ist.(22) In der Gestaltung der Stadtwahrnehmung des Westwärts-Gedichtes tritt dies besonders in Erscheinung. Das Gedicht thematisiert die reale Reise Brinkmanns nach Austin (Texas), wo er eine Gastdozentur innehatte, und die Rückkehr nach Deutschland, mit der der 2. Teil einsetzt.
Das Flächengedicht über sechseinhalb Doppelseiten widersetzt sich bereits durch seine graphische Gestaltung einer konventionellen Rezeption, da es sich nicht linear lesen lässt. Stofflich bildet das Gedicht ein engmaschiges Gewebe aus autobiographischen Notaten, sinnlichen Wahrnehmungen und Zitatfragmenten aus dem Alltagswissen der Rock- und Popkultur wie Reflexionen über Sprache.
Trotz der Heterogenität des Gedichtfeldes lassen sich Themenkreise ausmachen, die das paradoxale Anspruch-Antwort-Gefüge reflektieren und strukturell vollziehen und zusammen ein Beziehungsgeflecht darstellen, in dem Ich und Welt vorgängig verspannt sind . Die Ebene der sinnlichen Wahrnehmung, die sich körperlich mit der raumzeitlichen Örtlichkeit der Stadtsituation verknüpft, stellt ein Thema vor, das in dem Wahrnehmenden einen Prozess der Selbstvergewisserung auslöst, die sowohl das Verhältnis des Ich zum Wahrgenommenen als auch zur eigenen Geschichtlichkeit oder genauer: zur Frage der Identität des Ich in der Zeit umfasst. Als dritter thematischer Aspekt ist die poetologische Dimension des Textes anzuführen, die die Frage der Versprachlichung dessen, was widerfährt, durchgehend erhebt.
Gleich der elliptische Eingangssatz: „`Zurückgekehrt in dieses traurige alte Europa´“(23) reißt durch seine Kenntlichmachung als Zitat eine Kluft auf, zwischen dem, was dem Sprechenden als Anspruch widerfährt und dem, was ihm in einer angemessenen Sprache zu sagen, verwehrt ist, und sich dem Sprechenden entzieht. Denn das Zitierte reiht das einmalige Ereignis der Ankunft in eine fremde Rede ein, womit es zu einem Seinesgleichen wird. Im Folgenden sucht der Text in wiederholten Anläufen zu sagen, was dieses alte Europa an diesem Ort, wo der Reisende nach seiner Rückkehr aus den USA sich befindet, ist und wer er ist, innerhalb dieser Welt. Es durchdringen sich Wahrnehmungen, Wahrgenommenes mit Reflexionen über den Wahrnehmungsvorgang. Dabei geschehen ständige Rückkopplungen vom Gesehenen auf das Denken, auf das ,was das Gesehene beim Wahrnehmenden auslöst, begleitet stets von Reflexionen über Sprache, über ihre Mitteilungstauglichkeit, wobei die Beziehung von Erlebtem und sprachlichem Ausdruck in den Fokus rückt. Der sprachkritische Einwurf: „Ich möchte Wörter benutzen, die / nicht zu benutzen sind“(24), wendet sich gegen die Auffassung, Sprache fungiere ähnlich einem Werkzeugkasten – als ein Organon –, aus dem man sich bei Bedarf bedienen könne, um Erfahrenes, Bewusstseinszustände zu bearbeiten. Wörter, die zu benutzen sind, erweisen sich als Instrumente, die unabhängig vom Erlebten vorliegen, und nach Gebrauch das, was zur Sprache gelangen will, verformen und verallgemeinern. Überdies berührt Brinkmann damit Merleau-Pontys Paradox des Ausdrucks, das darin besteht, eine Übersetzung ohne vorgegebenen Urtext zu sein, etwas, das den Anspruch erhebt, einen Ausdruck zu erlangen, das sich im Augenblick des Ausgedrücktseins bereits entzogen hat, gleichwohl allein als Ausgedrücktes zu existieren vermag. Die Gedichtüberschrift „Variation ohne ein Thema“(25) trifft genau diesen Sachverhalt.
Der graphisch versetzt stehende Einwurf, der Linien zu Büchners Figur des Danton zieht, radikalisiert die Sprachproblematik: “sollte ich mir / das Gehirn aufbrechen und / zeigen, was darin ist?“(26)
Der Mitteilungswunsch bleibt bei aller Skepsis bestehen, denn es heißt ja: „Ich möchte Wörter benutzen“. Die Intention ist, das Innere des Gehirns, Bewusstseinsvorgänge ohne Medium bzw. Vermittlung zu zeigen: Das wäre die Alternative zu den Wörtern. Um nicht das Gehirn aufbrechen zu müssen, um wahrnehmbar werden zu lassen, was drin ist, deshalb ist die Sprache nicht zu umgehen. Parallel zu der Sprachthematik stehen die Zeilen: „Ich möchte / nur wieder einmal /über einen Tanzboden schwofen“. Ein konventioneller Satz, der Künftiges wie Vergangenes umgreift und das Ich in seiner Geschichtlichkeit ins Spiel bringt. Es erfolgt ein Blickwechsel auf die Materialität der Sprache: „Ich schaute auf / diese Wörter. / Ich versuchte einen Sinn darin / zu erblicken.“ Die Differenz zwischen den vorliegenden Wörtern und dem, was drängt, wahrnehmbar zu werden, ohne dass es zugänglich ist, entzweit das Ich: „Ich dachte daran, wie jetzt /das Innere des Bewußtseins / erscheinen mochte“(27).
Auf der einen Seite das Ich, das denkt – „Ich dachte“ –, auf der anderen Seite „das Innere des Bewußtseins“, dem das Ich zugewandt ist. Beides vermag als ein Selbstbezug angesprochen zu werden, in dem das Ich allerdings sich selbst nicht erreicht: Es denkt, „wie das Innere des Bewußtseins erscheinen mochte“. [Herv. d. Verf.] Das thematisierte „Innere des Bewußtseins“ liegt schon vor, auf das sich das Denken erst nachträglich richtet. Indem das Innere des Bewusstseins als etwas schon Vorliegendes dem an es denkenden Ich vorausgeht, tritt im Grunde das auf sich selbst bezogene Ichbewusstsein auseinander. Insofern das Ich sich von dem Inneren des Bewusstseins angesprochen fühlt und darauf antworten möchte – es will die Art und Weise seines vorliegenden Erscheinens wissen – geht das Ich als Moment des Selbstbezugs, welches das Innere repräsentiert, sich selbst voran. Dass in dem versuchten Antworten das Ich sich selbst uneinholbar immer schon voraus ist, wird auch dadurch kenntlich, dass Brinkmann nicht von „meinem“ Inneren schreibt, sondern unpersönlich „das Innere“ beruft. Das Auseinandertreten der Icherfahrung verdoppelt sich gleichsam, indem der Blick auf die Zeitlichkeit des Inneren, auf dessen In-der-Zeit-Sein gelenkt wird: „Das Innere des Bewußtseins / […] das / einmal vollständig angekleidet // mit Zeitungspapier um / die Kinderschuhe gewickelt / zu Bett gebracht worden war.“(28)
Der Rückgriff auf eine Kindheitserfahrung schließt nicht die Kluft, sondern macht sie nur noch stärker kenntlich, denn auch sie zeigt sich – als dem unzugänglich Inneren zugehörig – vom „Ich dachte“ abgetrennt und zugleich diesem doch zugeeignet, eben als ein sich entzogen Habendes.
Die Wörter sagen etwas, rufen etwas auf, aber es gibt offenbar eine Differenz zwischen Wort und dem, was aufgerufen worden ist, das der widerwendigen Logik des angeführten Paradox des Ausdrucks folgt.
Diese Szene, in der der Sprechende über die Möglichkeit der Sprache, sich selbst auszudrücken, nachdenkt und im Nachdenken darüber das Auseinandertreten der Selbsterfahrung erlebt, geschieht, als der Reisende am Flughafen sich der Passkontrolle unterzieht. Der gesellschaftlich sanktionierten Identitätsüberprüfung – „Ich ließ / sie auf das Foto / schauen. Ich ließ / sie in mein Gesicht / schauen“(29) – antwortet die dichterische Identitätsprüfung, die allerdings zu keiner Form bzw. keiner befriedigenden Bestätigung der Identität führt.
Vom Druckbild her nebeneinander gesetzt – Passkontrolle und Auseinandertreten des Selbst (nicht möglicher Selbstvergewisserung) – können die beiden Weisen der Identifizierung noch einmal wie Anspruch und Antwort gelesen werden. Der Zumutung der öffentlichen Identifizierung, wobei das Passfoto eine Identität zu verbürgen vermag, die dem dichterischen Wort versagt ist, antwortet der dargestellte Versuch der Selbstvergewisserung, der dem Ich die Erfahrung des Selbstverzugs zuteilwerden lässt.
Aufeinander bezogen gestaltet diese Doppelszene ein zweifaches Auseinandertreten der Erfahrung. Die gesellschaftlich sanktionierte Identität provoziert Antworten, die zum einen den öffentlichen Ansprüchen nicht gerecht sein können, zum anderen rufen sie Antworten hervor, in denen das Ich sich selbst vorausgeht wie entgleitet.
Großstadtansprüche anderer Art, die das Ich treffen, und bei denen das Ich der Antwort nicht in der Weise vorausgeht, dass es sich uneinholbar in seinem eigenen Zeitlichsein verliert, sondern Halt findet in einer es und die Dinge umspannenden Wirklichkeit, in der sich die Zeit gleichsam räumlich petrifiziert, werden oftmals in den Texten mit einer Geste beschworen, die das beschriebene Auseinandertreten zu bannen sucht. Es handelt sich um Augenblicke, Momente, wie Brinkmann schreibt, in denen das Ich eine wesentliche Verwandlung erfährt. Es wandelt sich vom Einstrahlungsfeld fremder, uneinholbarer Ansprüche zu einem Ort der Aufmerksamkeit. Derart ausgerichtet wird es zum Hüter der Wirklichkeit, wobei das Wort Hüter hier zweierlei bedeuten soll: zum einen bezeichnet es den Hüter, der für etwas Sorge trägt, gleichsam den Bewahrer oder Garanten der Wirklichkeit, zum anderen impliziert es das Auf-der-Hut-Sein vor falschen Ansprüchen. Ein solcher Augenblick, der dem Sprechenden auf einem Spaziergang durch seine Heimatstadt Köln widerfährt, indem er diesem zugleich seine Aufmerksamkeit schenkt, wird wie folgt beschrieben: „nächster Moment. Ich springe über den Schatten: die Betrachtung des einzelnen Blattes, das langsam mit viel Zeit, abgerissen vom Ast, von einem Baum herunterfällt, schwebend, dauert lange, hält an, in der Luft, ein fast schwereloses Flirren, exakt, in einem anderen Zeitraum, mit einem anderen Zeitmaß, wenn da überhaupt ein Zeitmaß ist, gegenwärtig und den anderen Zeitraum sichtbar machend im empfindlichen Bewußtsein, feines Dunkel der Helligkeit, feines Hell der Dunkelheit und anders, präzise, jetzt“(30).
Die Aufmerksamkeit, die der Betrachter dem unscheinbaren Herunterfallen des Blattes gewährt, hat ihren Ort in dem Spannungsbogen, der von dem, was ihm auffällt und anspricht, eben die schwebende Weise des Blattfalls, hinüberführt zu dem, was er zur Antwort gibt. In diesem schmalen Textabschnitt wird ein solcher Spannungsbogen thematisch. Die Ruhelosigkeit, die das Auseinander von Anspruch und Antwort erzeugt, wodurch das Ich sich selbst in der Erfahrung uneinholbar voraus ist, scheint hier für einen Moment aufgehoben; „im empfindlichen Bewußtsein“ durchdringen sich Sehen und Gesehenes, ausbalanciert wie umgrenzt vom Zeitraum der Gegenwart.
In der Antwort auf diesen Stadtanspruch geht das erlebende Ich sich selbst nicht mehr voraus, sondern die temporale Kluft zwischen Erleben und Erfassen scheint sich im Augenblick der Aufmerksamkeit zu einem Zugleich verräumlicht zu haben, in dem in einem zumal die Grenzziehung, die Inneres und Äußeres entstehen lässt, nicht mehr wirksam ist. Stattdessen erfolgt eine andere folgenschwere Grenzziehung, und zwar diejenige, die das „Jetzt“, wie Brinkmann notiert, vor jeglichem Abwesendem abschließt. Die in der Bewusstseinseinstellung der Aufmerksamkeit statthabende Aufhebung des Innen-Außen-Gegensatzes, wodurch das Ich mit seinem „empfindlichen Bewußtsein“ zu erleben meint, bei der ´wirklichen Wirklichkeit´ angelangt zu sein, geschieht indes um den Preis des Verlusts des reflektierenden Selbstbewusstseins, das im Bewegungsspiel von Anspruch und Antwort, Anwesendem und Abwesendem erst entsteht.
Anmerkungen:
1 Zum Widerfahrnis als ein Grundphänomen der Erfahrung, in dem sich der szenische Charakter der Erfahrung zeigt, vgl. Bernhard Waldenfels. Bruchlinien der Erfahrung. Frankfurt a. M. 2002, S. 54–60. 2 Rainer Maria Rilke. Werke in drei Bänden. Hg. v. Rilke-Archiv. Bd. 3, Frankfurt a. M. 1966, S. 110, vgl. auch S. 111. 3 Zur Figur des Strudels als zentrales Kennzeichen der Großstadtwahrnehmung vgl. Eckhard Lobsien, Großstadterfahrung und die Ästhetik des Strudelns. In: Die Großstadt als Text. Hg. v. Manfred Smuda. München 1972, S.183–198, hier S. 185. 4 Vgl. ebd. S. 186. 5 Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften. In: Ders., Gesammelte Werke. Hg. v. Adolf Frisé. Reinbek b. Hamburg 1978, Bd. I, S. 9. 6 Paul Boldt, Auf der Terrasse des Café Josty. In: Die Berliner Moderne 1885–1914. Hg. v. J. Schutte u. P. Sprengel. Stuttgart 1987, S. 328. 7 Robert Musil (Anm. 5), S. 10. 8 Ebd. 9 Ebd., S. 11. 10 Zwischentitel des Ersten Buchs des „Mann ohne Eigenschaften“. 11 Zur Deutung von Musils Formel des Seinesgleichen als Normalisierung von singulären Ereignissen vgl. Bernhard Waldenfels, Phänomenologie der Aufmerksamkeit. Frankfurt a. M. 2004, S. 33–37. 12 Martin Heidegger, Sein und Zeit. Tübingen 1976, S. 129. 13 Ebd. 128. 14 Robert Musil (Anm. 5), S. 1195. 15 Robert Musil, Die Verwirrungen des Zöglings Törleß. In: Ders., Gesammelte Werke. Hg. v. Adolf Frisé. Reinbek b. Hamburg 1978, Bd. II, S. 65. 16 Rolf Dieter Brinkmann, Westwärts 1 & 2. Gedichte. Mit Fotos und Anmerkungen des Autors. Erweiterte Neuausgabe. Reinbek 2005, S. 325. 17 Rolf Dieter Brinkmann, Der Film in Worten. Prosa. Erzählungen. Essays. Hörspiele. Fotos. Collagen. 1965 – 1974. Reinbek 1982, S. 267. 18 Rolf Dieter Brinkmann, Der Film in Worten (Anm. 17), S. 249. 19 Ebd., S. 267. 20 Rolf Dieter Brinkmann, Westwärts 1 & 2. (Anm. 16), S. 144. Im Kontext lautet die Stelle: „Nun sag ein Ding. Oder / wie F. Mauthner sagt, jeder Gegenstand / ist eine Frage. Das sagt er in Die Sprache,/ 3ter März 1905“. 21 Rolf Dieter Brinkmann, Der Film in Worten (Anm. 17), S. 276. 22 Zum Phänomen des zeitlichen Auseinandertretens der Erfahrung vgl. Bernhard Waldenfels, Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden. Frankfurt a. M. 2006, S. 48–52. 23 Rolf Dieter Brinkmann, Westwärts 1&2 (Anm. 16), S. 72. 24 Ebd., S. 74. 25 Ebd., S. 193. 26 Ebd., S. 74. 27 Ebd. 28 Ebd. 29 Ebd. 30 Ebd., S. 330.
![]() Inhalt | Table of Contents 18. Nr.
Inhalt | Table of Contents 18. Nr. ![]()
For quotation purposes:
Hartmut Cellbrot: Anspruch und Antwort in Stadterfahrungen am Beispiel von Musil und Rolf Dieter Brinkmann –
In: TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. No. 18/2011.
WWW: http://www.inst.at/trans/18Nr/plenum_cellbrot.htm Webmeister: Gerald Mach last change: 2011-06-15