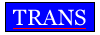 |
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften |
17. Nr. |
Januar 2010 |
|
| Sektion 3.4. |
Literaturen der Migration: Konfrontation und Perturbation als kreativer Impuls
Sektionsleiterin | Section Chair: Ursula Moser (Universität Innsbruck)
Dokumentation | Documentation | Documentation |
Julia Álvarez – Autobiographische Fiktion und Essay
zwischen Trauma und Kreativität
Verena Berger (
Universität Wien) [BIO]
Email:
verena.berger@univie.ac.at
So between you,
I often wonder who I am and where is my country
and where do I belong, and why I was born at all.
(Rhys 1977: 102)
Exil und Kreativität
In den letzten Jahrzehnten entwickelte sich in den USA eine in englischer Sprache verfaßte Literatur von AutorInnen mit Migrationshintergrund und/oder Exilerfahrung. Ihrem Erfolg bei der Leserschaft ist es zu verdanken, dass bedeutende Verlage wie Penguin Books, Algonquin Books oder Picador Romane, Lyrik oder Essays auch von ursprünglich aus Lateinamerika und dem karibischen Raum stammenden Schriftstellerinnen wie Cristina García, Sandra Cisneros, Esmeralda Santiago oder Julia Álvarez veröffentlichen. Die Werke dieser schreibenden Frauen, die außerhalb der Vereinigten Staaten mit dem Spanischen als Muttersprache aufwuchsen oder bereits in den USA zweisprachig oder englischsprachig heranwuchsen, werden auch als „Latino-Literatur“ bezeichnet.(1) Zentrales Thema dieser AutorInnen, die gleichzeitig dem hispanoamerikanischen/karibischen und dem nordamerikanischen Raum zugerechnet werden können und die, wie es William Luis im Titel seines Essays Dance Between Two Cultures: Latino Caribbean Literature Written in the United States (1997) formulierte, „zwischen den Kulturen tanzen“, ist der Versuch, im Spannungsfeld zwischen Herkunftskultur und dem Gastland USA eine neue Identität(2) zu finden.
In ihrem Aufsatz „Autopsie de l´exil ou: Nancy Huston face à l´écriture“ betont Ursula Mathis-Moser, dass Human- und Sozialwissenschaften in der Regel dazu tendieren, Exil(3) und seine Folgen problematisch darzustellen. Oftmals kommt es dabei zu einer Fokussierung auf negativ besetzte Begriffe wie beispielsweise Entwurzelung, Entfremdung, Verlust und fehlendes Zugehörigkeitsgefühl des betroffenen Individuums. (Mathis-Moser 2007: 109) Diese These teilen auch John D. Peters, der Exil mit Leid und Traumatisierung verknüpft (Peters 1999: 19), und Edward Said, der in „Reflections on Exile“ die Unmöglichkeit unterstreicht, jene Trauer zu überwinden, die der Verlust von Heimat impliziert. (Said 1990: 357 ff.) Eine generelle Skepsis, ob Exilerfahrung und ihre künstlerische und/oder intellektuelle Fruchtbarmachung tatsächlich mit einer positiven Bewertung einhergehen können, hebt auch Helga Schreckenberger im Vorwort zu Die Alchemie des Exils: Exil als schöpferischer Impuls hervor. (Schreckenberger 2005: 10)
Laut Said kann Exil jedoch auch positiv besetzt sein, wenn es dem Individuum zu einer Loslösung aus schwierigen, bedrohlichen oder gar gefährlichen Lebensbedingungen verhilft. Es ist daher nicht verwunderlich, dass gerade unter Exilierten viele SchriftstellerInnen und KünstlerInnen zu finden sind, zumal Exilerfahrung in kreativen Schaffensprozessen verarbeitet werden kann. (Said 1990: 363) Émile Cioran geht noch einen Schritt weiter, wenn er von den ‚Vorteilen des Exils‘ und der Freisetzung des kreativen Potentials als Resultat einer „école de vertige“ (Cioran 1997: 65 ff.) spricht. Gemäß der These des Filmwissenschafters Hamid Naficy kann gerade eine Situation wie das Exil – also ein Zustand, in dem sich Vertrautes in Unbekanntes, Natürliches in Unnatürliches wandelt – dem/der Exilierten zu einer „enviable position of being able to remake themselves“ (Naficy 2001: 269) verhelfen.
Anhand des Beispiels der Schriftstellerin Julia Álvarez soll im Folgenden der Frage nachgegangen werden, ob Exil als Auslöser für ein „remake“ im Sinne einer Neudefinition des eigenen Ich fungieren kann. Relevant erscheint dabei die Biografie von Álvarez, um jene Mechanismen aufzuzeigen, die letztlich aus der Situation des Exils über den Prozeß der Neudefinition zu Kreativität führen. Darüber hinaus fokussiert das literarische Werk von Álvarez vor allem auf Motive wie doppelte Identität, Hybridität(4) und Akkulturationsprozeß als Folgen von Exil. Ihr kreatives Schaffen ist demnach sowohl in der Genese als auch hinsichtlich der Thematik stark an die eigene Exilerfahrung gekoppelt: Es ist Produkt des Exils und spiegelt die durch das Exil bedingte Bikulturalität und Zweisprachigkeit der Autorin wider.
Ausgehend von Julia Álvarez´ autobiographischem Roman How the García Girls Lost Their Accent (1991) und ihrem Essay Something to Declare (1998) soll in der Folge dargestellt werden, wie das Trauma des Verlustes und das Exil die Ausbildung einer kreativen Ich-Identität begünstigen. Dabei steht die These im Vordergrund, dass der Impuls zum kreativen Schreiben mit der Notwendigkeit einer Neudefinition des eigenen Ich einhergeht, die bei Álvarez vor allem auf zwei Ebenen zu orten ist: die Konfrontation mit der Frage des schöpferischen Potentials der Exilerfahrung und die Konfrontation mit der Gender-Frage.
Exil-Biografie und die Neudefinition des eigenen Ich
Julia Álvarez wurde 1950 in New York geboren. Kurz darauf kehrten ihre Eltern in die Dominikanische Republik zurück, wo sie mit ihren drei Schwestern im Kreis einer begüterten und gesellschaftlich anerkannten Familie aufwuchs. Da sich der Vater von Álvarez als Aktivist der Widerstandsbewegung gegen die Diktatur von Rafael Leonidas Trujillo Molina (1930-1961) in Lebensgefahr befand, mußte die Familie 1960 nach New York ins Exil gehen. In ihrem Essay Something to Declare berichtet die Autorin, dass sie im Alter von nur 10 Jahren nicht in der Lage war, die Folgen der plötzlichen Abreise aus der Dominikanischen Republik bewußt zu erfassen: „All we ever heard about was that we were taking a vacation to the United States.“ (Álvarez 1998: 17) „Overnight, we lost everything: a homeland, an extended family, a culture, and […] the language I felt at home in.“ (Álvarez 1998: 139)
Die Vereinigten Staaten, ihre Kultur und die englische Sprache waren keineswegs unbekannt für Julia Álvarez. Vielmehr pflegte ihre Familie bereits in der Dominikanischen Republik engen Kontakt mit dem Nachbarland. Den Eltern diente das Englische als eine Art Geheimsprache(5), bis sie und ihre Schwestern schließlich amerikanische Schulen besuchten und der Sprache selbst mächtig waren: „Say it in English so the children won´t understand.“ (Álvarez 1998: 22) Wie Álvarez betont, war die Begeisterung ihrer Familie für alles, was mit den Vereinigten Staaten in Verbindung stand, nicht nur eine Strategie, um dem „American Dream“ zu entsprechen, sondern vielmehr eine Überlebensstrategie während der Trujillo-Diktatur:
What kept my father from being rounded up with the other [political dissidents] each time there was a purge [...] was his connection with my mother´s powerful family. It was not just their money mat gave them power, for wealth was sometimes an incentive to persecute a family and appropriate its fortune. It was their strong ties with Americans and the United States. As I mentioned, most of my aunts and uncles had graduated from American schools and colleges, and they corresponded regularly with their classmates and alumni associations [...]. The family subscribed to American magazines, received mail order catalogues, and joined American clubs and honorary societies. This obsession with American things was no longer merely enchantment with the United States, but a strategy for survival. (Álvarez 1988: 80)
Die Ermordung von Trujillo im Jahr 1961 hätte eine Rückkehr der Familie von Julia Álvarez in die Dominikanische Republik ermöglichen und damit das Ende des Exils bedeuten können. Doch nach einer kurzen Reise in die Heimat mußte der Vater von Álvarez feststellen, daß die Instabilität der politischen Lage anhielt.(6) Der weitere Verbleib der Familie in New York stand daher unter dem Vorzeichen, dass zwar mit dem Tod des Diktators die unmittelbare Gefahr eliminiert, eine definitive Rückkehr in die Dominikanische Republik jedoch aus psychologischen Gründen nicht umsetzbar war.(7)
Auf Wunsch der Eltern, die auf diese Weise einem Verlust der eigenen Traditionen und Sprache entgegenwirken wollten, verbrachten Julia Álvarez und ihre Schwestern die Sommermonate in der Dominikanischen Republik. Diese Reisen zurück ins ‚verlorene Paradies‘ vermochten das anfänglich entstandene Gefühl der Entwurzelung zu lindern, weckten aber gleichzeitig auch die Illusion, in eine idealisierte Vergangenheit zurückkehren zu können. Durch den Vergleich der Lebensbedingungen in den USA und in der Dominikanischen Republik lernte Álvarez allmählich die Vorteile zu schätzen, die ihr der Verbleib in New York bot. Während ihrer Reisen stellte sie nicht nur fest, dass die karibische Insel nach der eigenen Akkulturation in den Vereinigten Statten nicht mehr ihrem Heimatgefühl entsprach: „[The] Island was old hat […]. Island was the hair-and-nails crowd, chaperones, and icky boys with all their macho strutting and unbuttoned shirts and hairy chests with gold chains and teensy gold crucifixes.“ (Álvarez 1991: 106-107) Der ‚rückwärtsgewandte Blick‘(8) im Sinne von Suleiman (1998: 5) auf die Heimat, die nun „inselhaft” (Herzog 2003: 304), altmodisch und dem Lebensgefühl der Protagonistin entgegen gesetzt wirkte, verlor damit an Kraft. Als ‚gringa-dominicana‘ fühlte sich Álvarez in der Figur ihres Alter Ego dem wiederentdeckten Kulturkreis nicht mehr zugehörig. Gleichzeitig erkannte sie aber auch die Chance, das eigene Selbstverständnis aus der Distanz heraus neu zu bestimmen.
Wie Edward Said betont, ermöglicht gerade diese Multiplikation der Perspektiven Exilierten oder Heimatlosen – und vermehrt noch exilierten Frauen – den kritischen und distanzierten Blick auf das Herkunftsland und auf die Aufnahmegesellschaft: „Most people are principally aware of one culture, one setting, one home; exiles are aware of at least two, and this plurality of vision gives rise to an awareness of simultaneous dimensions, an awareness that is [...] contrapuntal.“ (Said 1990: 366) Die Exilerfahrung zwang Álvarez daher zu einer tiefgehenden Reflexion über ihre eigene Identität und a posteriori zu deren Infragestellung: Was wollte sie vom kulturellen Erbe ihrer Vergangenheit in der Dominikanischen Republik bewahren, was wollte sie über Bord werfen? Aus der Perspektive der doppelten Verortung gelang es der Autorin, die Rolle der Frau in der Tradition ihres Herkunftslandes in Frage zu stellen und gleichzeitig ihren eigenen Befreiungsprozeß zu durchlaufen.
Trauma als Katalysator für Kreativität
Die Exilierung in den Vereinigten Staaten löste bei Julia Álvarez einerseits die traumatische Erfahrung des Verlusts von Heimat und Sprache aus und bewirkte eine Entfremdung von der Herkunftskultur. Zum Anderen gerieten ihr Exil und die damit einhergehende Entwurzelung auch zum Katalysator einer konstanten Neudefinition ihres eigenen Ich. Bei diesem Prozeß können die Auseinandersetzung mit den Folgen eines Traumas, sein erneutes Durchleben (Caruth 1996: 4), die bewußte Konfrontation mit dem Verlust und die Überwindung der Unfähigkeit, das Erlebte sprachlich zu artikulieren (McClennen 2005: 169 ff.), auf die eigene Persönlichkeitsbildung stark dynamisierend wirken. Die zunehmende Ablehnung der eigenen Kulturtradition und die parallel dazu wachsenden Anforderungen des Prozesses einer Anpassung an die US-amerikanische Kultur verdeutlichten Álvarez die Notwendigkeit, für die Konstruktion eines neuen Ich andere Ressourcen finden zu müssen: „In this new culture, my sisters and I had to find new ways to be, new ways to see, and – with the change in language – new ways to speak. It was the opportunity to create ourselves [...] that led me to become a writer.“ (Álvarez 1998: 156)
Was den Zusammenhang zwischen Exil und Kreativität betrifft, geht Julia Kristeva davon aus, dass der literarische Schaffensprozeß durch das Bewußtwerden der eigenen Fremdheit hinsichtlich des Ursprungslandes, der Muttersprache, der Gender-Frage oder der eigenen Identität unterstützt wird: „Writing is impossible without some kind of exile.“ (Kristeva 1986: 298) Auch für Detlef B. Linke ist der Ursprung von Kreativität in erster Linie an die Loslösung von einer althergebrachten Struktur gekoppelt, die im Sinne einer „Entkoppelung zwecks neuer Koppelung“ (Linke 2001: 130) zugunsten eines neuen Gefüges aufgegeben wird. Die traumatisch erlebte Fremdheit, die als Folge des Exils durch die Verlagerung des Lebensmittelpunktes in einen anderen Kulturkreis entsteht, wurde auch für Álvarez zum Katalysator für die Konstruktion eines neuen Ich und führte letztlich zum literarischen Schreiben. Die Entfernung von der Bezugsgruppe, dem Familienverband oder einer Großfamilie als Folge des Exils(9) und der damit einhergehende Verlust eines vertrauten Personenkreises beschleunigten den Prozeß der Bewußtwerdung, dass eine Neudefinition des eigenen Ich unter den bestehenden Rahmenbedingungen überlebensnotwendig wird. Die amerikanische Lebensweise, die weitgehend dem Motto „Be your own person!“ (Álvarez 1998: 121) folgt, wirkte stimulierend auf Álvarez, die nicht darauf vorbereitet war, außerhalb der gewohnten Familienbande zu bestehen. Vielmehr mußte sie sich daran gewöhnen, dass – im Gegensatz zu den Gepflogenheiten in der Dominikanischen Republik – in den USA Beruf und Gesellschaftsleben nicht von der Familie, sondern in erster Linie von einem selbst bestimmt werden. Für Álvarez brachten die neuen Lebensumstände daher eine Befreiung von einer Kontrolle ihrer Person, wie sie in der karibischen Ursprungskultur traditionellerweise die Familie ausübt, mit sich.
In ihrer Studie über lateinamerikanische Schriftstellerinnen im Exil betont Amy Kaminsky, dass die Erfahrung eines physischen und emotionalen Bruchs zu einer Transformation des eigenen Ich führen kann, wenn der/die Betroffene die eigene Fähigkeit entdeckt, in der neuen Umgebung nicht nur zu überleben, sondern sich sogar weiterzuentwickeln (Kaminsky 1993: 37). Kaminsky vergleicht diesen Prozeß des Entdeckens eines eigenen Ich mit einer Wiedergeburt, der Entwicklung einer neuen Persönlichkeit und einer neuen Subjektivität. Im Spannungsfeld von geographischer und emotionaler Ferne und Nähe wurde sich Julia Álvarez bewußt, dass ihre Herkunftskultur, die Dominikanische Republik, von ausgeprägt hierarchischen Gesellschaftsstrukturen und einem fest verankerten Patriarchat bestimmt ist. Das dort herrschende Sozialgefüge basiert auf der Unterwerfung der Frau, der innerhalb dieser Parameter nur die traditionellen Rollen als Ehefrau, Hausfrau und Mutter zugestanden wird: „Our emigrations from our native countries and families helped us to achieve an important separation from a world in which it might not have been easy for us to strike out on our own, to escape the confining definitions of our gender roles.“ (Álvarez 1998: 174)
Kaminsky stellt des Weiteren fest, dass nicht nur Männer, sondern auch Frauen unter dem Verlust der kulturellen Wurzeln im Exil leiden. Dennoch birgt Emigration für Frauen vielfach auch den Vorteil in sich, ihr Leben in größerer Freiheit leben zu können, zumal Sexismus oder repressiver Machismus, die in ihrem Herkunftsland oftmals bestimmend sind, nun wegfallen (Kaminsky 1993: 39). Aus diesem Grund entwickeln exilierte Frauen häufiger als Männer eine positiv besetzte Beziehung zu ihrem Gastland. Die Aufnahmegesellschaft löst bei ihnen nicht unbedingt ein starkes Gefühl der Entwurzelung aus. Vielmehr bedeutet das Exil für Frauen oft eine Befreiung von den sozialen Zwängen des Ursprungslandes. Auch Álvarez stellte fest, dass Frauen in der Dominikanischen Republik weder im öffentlichen noch im privaten Leben eine Rolle spielten (Álvarez 1998: 122). Die traditionellen Werte ihres Kulturkreises hätten es ihr nicht ermöglicht, eine andere Laufbahn einzuschlagen als jene, die Frauen in der karibischen Gesellschaft zugedacht ist.(10) Die Auflehnung gegen diese Traditionen und die Möglichkeiten, die die US-amerikanische Gesellschaft Álvarez bot, unterstützten daher ihre persönliche Befreiung als Frau und in der Folge ihre berufliche Entwicklung als Schriftstellerin: „For me [...] as a writer, I had to free myself from certain restrictions – physical and mental – of being a Dominican female before I could rediscover and embrace the Latina in my writing.“ (Álvarez 1998: 174) Damit wurde für Álvarez der Raum des (Post-)Exils gleichzeitig auch zum kreativen Raum, der ihr das literarische Schreiben ermöglichte. (Johnson 2005: 54 ff.)
Bereits in ihrer Jugend war Julia Álvarez bewusst, dass sie Schriftstellerin werden wollte. In ihrem Essay Something to Declare schildert die Autorin zudem, wie sie seit ihrer Kindheit eine starke Affinität zur Figur der Scheherezade aus Tausendundeiner Nacht verspürte. Die Erzählerin aus dem fernöstlichen Märchen, die mit ihren Geschichten mit für das weibliche Geschlecht untypischen Waffen das Morden an Frauen bekämpft, greift damit aktiv in eine Welt ein, die Männern vorbehalten ist. Über die mythische Figur der Scheherezade, die mit dem Erfinden und Erzählen von Geschichten ihr eigenes Leben und das ihrer Geschlechtsgenossinnen rettet, verstand Álvarez, dass „[...] stories could save you.“ (Álvarez 1998: 138) In Anlehnung an Scheherezade aus Tausendundeiner Nacht wurden Erzählen und Schreiben für sie zu einem Instrument, dank dessen sie nicht nur Trauma und Verlust verarbeiten, sondern gleichzeitig ihr Überleben in der Bikulturalität und Bilingualität sichern konnte.(11) Das Exil in New York, die obligatorische Konfrontation mit dem Englischen als Kommunikationssprache und das Gefühl der Isolierung förderten Álvarez´ Annäherung an Literatur und die Umsetzung ihres Wunsches zu schreiben: „The feeling of loss caused a radical change in me. It made me an introverted little girl.” (Garcia Johnson, o.J.) Aus dem Rückzug in das eigene Ich und der Einsicht, sich in der Schulgemeinschaft nicht integriert und von den KlassenkameradInnen als „spic”(12) verspottet zu fühlen, erwuchs schließlich Álvarez´ Bestreben, die englische Sprache perfekt zu erlernen. Hinter diesem Ziel stand die Hoffnung, in Zukunft von den AmerikanerInnen nicht mehr als Fremde oder Ausländerin erkannt zu werden. Auf diese Weise wurde Álvarez ein in ihrer Jugend als Migrantin entstandenes Gefühl der Rache zum weiteren Impuls, eine Laufbahn als Schriftstellerin einzuschlagen:
Looking back now, I can see that my path as a writer began in the playground. Somewhere inside, where we make promises to ourselves, I told myself I would learn English so well that Americans would sit up and notice. I told myself that one day I would express myself in a way that would make those boys feel bad they had tormented me. Yes, it was revenge that set me on the path of becoming a writer. (Álvarez 1998: 140-141)
Auch die durch ihre Fremdheit bedingte Introvertiertheit geriet Álvarez zu einer produktiven Strategie: „Inside my head a rich conversation had started, inspired by the world of books.” (Álvarez 1998: 139) Vor allem ihre LehrerInnen in New York spornten sie dazu an, alles, was mit dem Verlust des ‚karibischen Paradieses‘ und den daraus erwachsenen Nostalgiegefühlen in Verbindung stand, aufzuschreiben: „By rubbing the lamp of language, I could make the genie appear: the sights, sounds, smells, the people and places of the homeland I had lost. I realized something I had always known [...]: language was power.” (Álvarez 1998: 140) Der Verlust der Muttersprache Spanisch, die im Exil auf den Kreis der engsten Familie beschränkt blieb, und die Tatsache, sich mit einer neuen Sprache – dem Englischen – konfrontieren zu müssen, zwangen Álvarez dazu, sich mit großer Genauigkeit sowohl mit der Bedeutung als auch mit dem Klang der einzelnen Wörter auseinander zu setzen. Nur dank dieser Präzisionsarbeit gelang es der Autorin schließlich, ihr literarisches Werk in englischer Sprache schreiben zu können.
Mit Akzent schreiben - Schreibend den Akzent verlieren
Julia Álvarez hat ihr gesamtes Werk in englischer Sprache verfaßt: How the García Girls Lost Their Accent (1991), In the Time of the Butterflies (1995), ¡Yo! (1997), In the Name of Salomé (2000) oder Saving the World (2006), um nur einige ihrer Veröffentlichungen zu erwähnen, die einen weiten Bogen spannen von autobiografischer Fiktion, Roman, Lyrik, Kurzgeschichten bis hin zum Essay.(13) Mit dem Schreiben in englischer Sprache gab Álvarez zwar die Muttersprache Spanisch als literarisches Ausdrucksmittel auf, sie betreibt aber gleichzeitig ein „writing with an accent“, wie es Taghi Modarressi formuliert:
The new language of any immigrant writer is obviously accented and, at least initially, inarticulate. I consider this „artifact“ language expressive in its own right. Writing with an accented voice is organic to the mind of the immigrant writer. It is not something one can invent. It is frequently buried beneath personal inhibitions and doubts. The accented voice is loaded with hidden messages from our cultural heritage, messages that often reach beyond the capacity of the ordinary words of any language… Perhaps it is their [immigrant and exile writers’] personal language that can build a bridge between what is familiar and what is strange.(14)
Dass Álvarez das Englische zur Sprache ihres literarischen Werks machte, ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass die Autorin nach ihrer akademischen Ausbildung an Colleges und Universitäten in zahlreichen Städten der USA kreatives Schreiben und Literatur lehrte. Dessen ungeachtet steht das literarische Werk von Álvarez weitgehend im Zeichen des Zusammenspiels von hispanoamerikanischer/ karibischer und nordamerikanischer Kulturtradition. Die Hybridität, die sich thematisch und sprachlich in ihren Texten abzeichnet, markiert nicht nur ihre Literatur, sondern ist auch Resultat der Exilerfahrung der Autorin. Ihr Roman How the García Girls Lost Their Accent, der als ‚Patchwork-Roman‘ oder als Zyklus von Kurzgeschichten klassifiziert werden kann, vereint im Stil des Storytelling viele Erzählstränge in sich und beruht auf autobiografischen Elementen, die Realität und Fiktion miteinander verknüpfen.(15) Diesbezüglich unterstreicht Álvarez in ihrem Essay Something to Declare die Selbstverständlichkeit, mit der gelebtes Leben vom erzählenden Ich literarisch umgesetzt wird:
One of my theories [...] is that there is no such thing as straight-up fiction. There are just levels of distance from our own life experience, the thing that drives us to write in the first place. In spite of our caution and precaution, bits of our lives will get into what we write [...]. (Álvarez 1998: 275)
Julia Álvarez´s Exilerfahrungen finden in ihrem 1991 in englischer Sprache veröffentlichten Roman How the García Girls Lost Their Accent ihren ersten Niederschlag. Dieses Werk, das als fiktionale Autobiografie gelesen werden kann, tastet sich kaleidoskopartig an das Herkunftsland – die Dominikanische Republik – und an das Gastland – die USA –, an Marginalisierung und Akkulturationsprozeß, an Vergangenheit und Gegenwart, an Erinnerung und Vergessen, an die karibische Kultur der Heimat und an die amerikanische Kultur heran.(16) Im Mittelpunkt der Handlung stehen vier Schwestern – Carla, Sandra, Yolanda und Sofia. Wie die Verfasserin selbst emigrieren die Protagonistinnen gemeinsam mit den Eltern nach New York. Die Tatsache, in den USA im Exil zu sein, zwingt die vier Schwestern dazu, ihren Lebensstil zu ändern. Einerseits verfügen sie nicht mehr über die Bequemlichkeiten, die ihnen die Heimat als Angehörige des gehobenen Mittelstandes bieten konnte, und andererseits sehen sie sich mit einer fremden Gesellschaft konfrontiert, die ihnen eine kulturelle Assimilierung abverlangt. Als Folge davon erleben Carla, Sandra, Yolanda und Sofia die Widersprüche zwischen den Gepflogenheiten, die in der Dominikanischen Republik ihren Alltag prägten und die im Exil von ihren Eltern weiterhin hochgehalten werden, und den Anforderungen, die der Akkulturationsprozeß in den USA an sie stellt.
In How the García Girls Lost Their Accent tritt die Parallele zwischen der Biografie der Autorin und ihrem Alter Ego in der Figur von Yolanda García deutlich zutage: Der Roman, der sich mit dem Lebenslauf von Álvarez zeitlich deckt, ist in drei Meta-Kapitel gegliedert, die rückläufig die Zeitabschnitte 1989 bis 1972, 1970 bis 1960 und 1960 bis 1956 behandeln und jeweils in weitere fünf Unterkapitel aufgefächert sind. Die zeitliche Reihenfolge erfährt dabei gelegentlich Veränderungen in der Chronologie. Die Erzählung beginnt und schließt mit der Stimme von Yolanda aus der Perspektive der Gegenwart, als Erwachsene. In den 15 zusammenhängenden Geschichten, die einen Zeitraum von 33 Jahren umfassen, verwendet Álvarez nur selten die Stimme einer dritten Person. Zur Orientierung der Leserschaft enthält die Überschrift der einzelnen Unterkapitel den Namen jener Figur, die der/die TrägerIn der Handlung ist und von dessen/deren Standpunkt aus eine Episode aus dem Leben der eigenen Person oder der Familie erzählt wird. Mithilfe dieser narrativen Strategie schafft die Autorin eine subjektive Perspektive, die die Leserschaft mit jedem Mitglied der Familie bekannt macht. Im Zusammenspiel mit der Heteroglossie des Textes sticht How the García Girls Lost Their Accent durch die gleichzeitige Thematisierung von Identitätsverlust und weiblicher Befreiung hervor: Die Polyphonie der Stimmen in erster und zuweilen in dritter Person legt Zeugnis ab von der Geborgenheit und Kraft, die Álvarez und ihre Schwestern – hier verkörpert durch die Figuren von Carla, Sandra, Yolanda und Sofia – aus der Solidarität unter Frauen, der gemeinsamen Erfahrung des Verlustes der karibischen Heimat und der Anpassung an die US-amerikanische Kultur beziehen.
Wie bereits dem Titel des Romans zu entnehmen ist, wird die Sprachenfrage in Verbindung mit der Frage nach der Identität zum Schlüsselthema. Die Auflehnung von Yolanda, das Alter Ego der Autorin, gegen die Herkunftskultur erreicht ihren Höhepunkt, als sie eine Rede für die Schule vorbereiten soll. Nachdem es ihr lange Zeit nicht gelingt, einen Text zu verfassen, findet sie schließlich dank des Gedichts Song of Myself von Walt Whitman ihre eigene Stimme in englischer Sprache. Das Gedicht inspiriert Yolanda dazu, eine rebellische, aufrührerische Ansprache zu entwerfen, die gegen die patriarchalen Werte und Regeln des Vaters Carlos García verstößt, und löst damit einen heftigen Familienstreit aus. (Álvarez 1991: 139 ff.) Aus ähnlichen Gründen mißfällt es dem Vater, dass seine Töchter die englische Sprache rascher und besser beherrschen als er selbst. Die Frage der Sprachenwahl führt letztlich auch dazu, dass der Vater von seiner Ehefrau verlangt, ausschließlich Spanisch zu sprechen. Diese hingegen weigert sich und wechselt weiterhin im Code-Switching zwischen Englisch und Spanisch:
She spoke in English when she argued with them. And her English was a mishmash of mixed-up idioms and sayings that showed she was ‚green behind the ears’, as she called it. If her husband insisted she speak in Spanish to the girls so they wouldn´t forget their native tongue, she´d snap, ‚When in Rome, do unto the Romans’. (Álvarez 1991: 132)
Die Sprachenfrage kulminiert schließlich im Kapitel „Joe“, als Yo ‑ die Abkürzung für Yolanda(17) ‑ ihren Eltern eröffnet, dass sie sich von ihrem Ehemann getrennt hat: „‚What happened, Yo?’ her mother asked the hand she was patting a little later. ‚We thought you and John were so happy.’ ‚We just didn´t speak the same language,’ Yo said, simplifying.“ (Álvarez 1991: 80)
Das „writing with an accent“ im Sinne von Modarressi tritt in Álvarez´ Roman in der Einbindung des Spanischen und in Textstellen mit Code-Switching zutage: Obwohl es für ihr Alter Ego Yolanda nach einigen Jahren in den USA leichter ist, sich in englischer Sprache auszudrücken, vergißt sie ihre Muttersprache nicht. Interjektionen oder einzelne Wörter wie ‚ay’, ‚¡Ya, ya!’ und ‚pobrecita‘ spielen auf die Zweisprachigkeit der Autorin an(18): „The guardia hit me. He said I was telling stories. No dominicana with a car would be out at this hour getting guayabas.” (Álvarez 1991: 22)(19) Im Roman sind zudem zahlreiche Ausdrücke, die für die spanische Varietät in der Dominikanischen Republik charakteristisch sind,(20) aber auch Übersetzungen von spanischen Redewendungen zu finden. Dazu zählen unter anderem bekannte Sprichwörter wie „Con paciencia y calma se sube un burro en una palma“ in der Übersetzung als „With patience and calm, even a burro can climb a palm“. (Álvarez 1991: 135) Die Beibehaltung des spanischen Ausdrucks für „burro“ (dt. Esel) in der englischsprachigen Version des Sprichworts, aber auch die Übertragung des Reims ins Englische stehen hier als Beispiele für das „accented writing“ in der Migrationsliteratur.
Ein literarisches Leitmotiv von Álvarez ist damit ‚Sprache als einzige Heimat’. In „Antojos“, dem ersten Kapitel von How the García Girls Lost Their Accent, läßt die Autorin Yolanda inmitten tiefer emotionaler Verunsicherung in die Muttersprache flüchten. Eine Reise in die Dominikanische Republik offenbart den Konflikt zwischen den beiden Sprachen Englisch und Spanisch:
In halting Spanish, Yolanda reports on her sisters. When she reverts to English, she is scolded, “¡En español!” The more se practices, the sooner she´ll be back into her native tongue, the aunts insist. Yes, and when she returns to the States, she´ll find herself suddenly going blank over some word in English or, like her mother, mixing up some common phrase. (Álvarez 1991: 7)
Neben der Thematik der Sprachenfrage steht in How the García Girls Lost Their Accent auch der Gegensatz zwischen maskuliner und femininer Wahrnehmung von Exil im Vordergrund. Während für den Vater die Exilerfahrung als Frustration verläuft, die in die Schwächung seiner traditionellen Rolle als Mann und Patriarch mündet, wirkt das Exil für seine Ehefrau Laura sowie für die vier Töchter stimulierend und förderlich für die eigene Selbstbestätigung. Obwohl sich die Mutter anfänglich der raschen Amerikanisierung ihrer Kinder widersetzt, erkennt sie bald die Vorteile, die ihr selbst aus den Möglichkeiten einer Emanzipierung erwachsen. Während ihr Ehemann immer noch dazu neigt, in die Dominikanische Republik zurückzukehren, ist Laura fest entschlossen, in den USA bleiben zu wollen:
But Laura had gotten used to the life here. She did not want to go back to the old country where, de la Torre or not, she was only a wife and a mother (and a failed one at that, since she had never provided the required son). Better an independent nobody than a high-class house slave. (Álvarez 1991: 140)
Álvarez unterstreicht damit in How the García Girls Lost Their Accent die Entwicklungsschancen, die das Exil einer Frau eröffnet, da sie sich außerhalb der gewohnten sozialen und familiären Zwänge artikulieren kann.(21) Letztlich nimmt Laura García sogar die Gelegenheit wahr sich weiterzubilden und gewinnt damit Vertrauen in ihre eigenen intellektuellen Fähigkeiten. Während das Exil für ihren Ehemann vom Verlust von Werten geprägt ist, denen außerhalb seines Kulturkreises nicht mehr die gleiche Relevanz zukommt – die Anerkennung als Mann, Familienoberhaupt, Patriarch – , bedeutet das Exil für seine Frau und Töchter Befreiung und Emanzipation. Der Wegfall der männlichen Vorherrschaft öffnet den Raum für weibliche Selbstbestätigung.
Kreative Konfrontation – literarische Kreativität als Folge von Exil
Wie das Beispiel von Julia Álvarez zeigt, kann Exil als anfänglich verunsichernder Zustand letztlich Katalysator für kreative Prozesse werden. Der Autorin gelingt es, das Trauma des Verlustes der karibischen Heimat, die daraus resultierende kulturelle Hybridität und den schöpferischen Impuls zu nutzen, der in der Exilerfahrung angelegt ist. Das unmittelbare Erleben der räumlichen Entgrenzung als Folge des Exils führt sie zu einer positiv besetzten Verarbeitung des Traumas, das sich als Motiv in ihrem literarischen Werk niederschlägt. In ihrem autobiografischen Roman How the García Girls Lost Their Accent rückt Álvarez daher nicht nur Transnationalität, globale Migrationsbewegungen und ihre Folgen in den Vordergrund, sondern sie hebt auch die „Überschneidung von Positionen und Identitäten, [das] Überlappen von Kulturräumen und Interessen sowie [den] Ursprung der meisten Kulturen als Mischkulturen“ hervor (Herzog 2003: 19-20). Die aus der Bikulturalität und Bilingualität resultierende Spannung, die nicht nur ihre Identität als Individuum und Frau, sondern auch als Schriftstellerin prägt, rückt daher in den Mittelpunkt, wenn Álvarez über ihre Zugehörigkeit zu einer nationalen Literatur als dominikanisch-amerikanische Autorin reflektiert:
I´m mapping a country that´s not on the map, and that´s why I´m trying to put it down on paper. It´s a world formed of contradictions, clashes, comminglings – the gringa and the Dominican [...] – and it is precisely that tension and richness that interests me. Being in and out of both worlds, looking at one side from the other side ... a duality that I hope in the writing transcends itself and becomes a new consciousness, a new place on the map, a synthesizing way of looking at the world. (Álvarez 1998: 173)
Álvarez, die sich selbst weder als eine US-amerikanische noch als eine dominikanische Autorin betrachtet, bricht als Folge ihrer Exilerfahrung und ihres eigenen Schreibens in englischer Sprache nicht nur mit dem Konzept von Nationalliteratur, sondern möchte vielmehr ihren eigenen Lebensraum und ihr kreatives Schaffen im Sinne der „borderlands“ von Gloria Anzaldúa als eine konstante Transformation verstanden wissen. (Anzaldúa ²1999: 3)
▲
Bibliografie
Primärliteratur
- Álvarez, Julia 1991, How the García Girls Lost Their Accents, Chapel Hill, Algonquin Books.
- Álvarez, Julia 1997, ¡Yo!, Chapel Hill, Algonquin Books.
- Álvarez, Julia 1998, Something to Declare, Chapel Hill, Algonquin Books.
- Danticat, Edwidge 1996 [1995], Krik? Krak!, London, Abacus.
- Rhys, Jean 1966, Wide Sargasso Sea, London, Deutsch.
Sekundärliteratur
- Álvarez, Julia 1988, „An American Childhood in the Dominican Republic“, in: The American Scholar 57.1, 77-87.
- Anzaldúa, Gloria ²1999, Borderlands/La Frontera, San Francisco, Aunt Lute.
- Augenbraum, Harold/Olmos, Margarite Fernández 1997, The Latino Reader: An American Literary Tradition from 1542 to the Present, Boston/New York, Houghton/Miflin.
- Caruth, Cathy 1996, Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History, Baltimore, MD, The John Hopkins University Press.
- Cioran, Émile 1997 [1956], La tentation d´exister, Paris, Gallimard.
- Clifford, James 1997, Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century, Cambridge, Harvard University Press.
- Clifford, James 1999, Itinerarios transculturales, Barcelona, Gedisa.
- De Toro, Alfonso 2005, „Paisajes-Heterotopías-Transculturalidad: Estrategias de hibridación en las literaturas latino/americanas: un acercamiento teórico“, in: Mertz-Baumgartner, Birgit/Pfeiffer, Erna (Hrsg.), Aves de paso. Autores latinoamericanos entre exilio y transculturación (1970-2002), Frankfurt am Main/Madrid, Vervuert-Iberoamericana, 19-28.
- Garcia Johnson, Ronie-Richele o.J., „Julia Álvarez“, in: http://www.lasmujeres.com/juliaalvarez/profile.shtml (27.01.2008).
- Hanne, Michael (Hrsg.) 2004, Creativity in Exile, Amsterdam/New York, Rodopi.
- Hall, Stuart 1992, „The Question of Cultural Identity”, in: Ibid. (Hrsg.), Modernity and its Futures: Understanding Modern Societies, London, Polity Press, 273-325.
- Herzog, Margarethe 2003, Lebensentwürfe zwischen zwei Welten. Migrationsromane karibischer Autorinnen in den USA, Frankfurt am Main, Lang.
- Johnson, Kelli Lyon 2005, Julia Alvarez: writing a new place on the map, Albuquerque, N.M., Univ. of New Mexico Press.
- Kaminsky, Amy 1993, Reading the Body Politic: Feminist Criticism and Latin American Women Writers, Minneapolis, University of Minnesota Press.
- Kaminsky, Amy 1999, After Exile: Writing the Latin American Diaspora, Minneapolis, University of Minnesota Press.
- Kristeva, Julia 1986, „A New Type of Intellectual: The Dissident“, in: Moi, Toril (Hrsg.), The Kristeva Reader, New York, Columbia University Press, 292-300.
- Linke, Detlef B. 2001, Kunst und Gehirn. Die Eroberung des Unsichtbaren, Hamburg, Rowohlt.
- Luis, William 1997, Dance Between Two Cultures: Latino Caribbean Literature Written in the United States, Nashville, Vanderbilt University Press.
- Mathis-Moser, Ursula 2007, „Autopsie de l´exil ou: Nancy Huston face à l´écriture“, in:
Mathis-Moser, Ursula/Mertz-Baumgartner, Birgit (Hrsg.), La littérature ‹française› contemporaine. Contact de cultures et créativité, Tübingen, Narr, 109-123.
- McClennen, Sophia A. 2005, „The Diasporic Subject in Ariel Dorfman´s Heading South, Looking North“, in: Melus 30.1, 169-188.
- Modarressi, Taghi 1992, „Writing with an Accent“, in: Chanteh 1, Nr.1, 7-9.
- Naficy, Hamid 2001, An Accented Cinema. Exilic and Diasporic Filmmaking, Princeton, New Jersey, Princeton University Press.
- Peters, John Durham 1999, „Exile, Nomadism and Diaspora. The Stakes of Mobility in the
Western Canon“, in: Naficy, Hamid (Hrsg.), Home, Exile, Homeland: Film, Media, and the Politics of Place, New York, Routledge, 17-41.
- Rubenstein, Roberta 2001, Home matters: longing and belonging, nostalgia and mourning in women's fiction, New York, Palgrave.
- Said, Edward 1990, „Reflections on Exile“, in: Ferguson, Russell/Gever, Martha/Minh-Ha,
- Trinh T./West, Cornel (Hrsg.), Out of There. Marginalization and Contemporary Cultures, New York/London, MIT-Press, 357-366.
- Schreckenberger, Helga (Hrsg.) 2005, Die Alchemie des Exils: Exil als schöpferischer Impuls, Wien, Praesens.
- Sirias, Silvio 2001, Julia Alvarez: a critical companion, Westport, Greenwood Press.
- Suleiman, Susan Rubin (Hrsg.) 1998, Exile and Creativity. Signposts, Travelers, Outsiders, Backward Glances, Durham, NC, Duke University Press.
Fußnoten:
(1) Vgl. dazu das Kapitel „The Latino Novel“ von Sirias 2001: 11 ff.
(2) Zum Konzept der Identität siehe Hall 1992: 297.
(3) Zum Begriff des Exils vgl. Hanne 2004: 3-5.
(4) Vgl. de Toro 2005: 19 ff.
(5) Obwohl Álvarez von einer „infancia americana en la República Dominicana“ spricht (siehe auch den Titel ihres Essays aus dem Jahr 1988), so stand die englische Sprache in der Zeit vor dem Exil in New York für einen „sound of worry and secrets, the sound of being left out.“ (Álvarez 1998: 22) Umso größer war Álvarez´ Bestürzung bei der Ankunft in den USA angesichts der Tatsache, dass zwar alle Englisch sprachen, diese Varietät jedoch nicht jenem Englisch entsprach, das sie in ihrer Heimat erlernt hatte.
(6) Der Besuch von Álvarez´ Vater in der Dominikanischen Republik findet im autobiografischen Roman How the García Girls Lost Their Accent Niederschlag in der Figur von Carlos García, der sich angesichts der Unmöglichkeit der Rückkehr damit abfindet, fortan eine bikulturelle Existenz leben zu müssen: „It is no hope for the island. I will became un dominican-york.“ (Álvarez 1991: 105)
(7) Zu den unterschiedlichen Beweggründen für Exilierung vgl. Said 1990: 362 ff.
(8) Zum Begriff des ,rückwärtsgewandten Blicks’ – „backward glances“ – vgl. Suleiman 1998: 5.
(9) Gemäß Clifford stellen Exil und Diaspora immer eine Situation der räumlichen Distanz oder der Trennung von einer vertrauten Bezugsgruppe dar. (1999: 303-312)
(10) Die aus Haiti stammende und in New York lebende Autorin Edwidge Danticat schildert in ihrem Roman Krik?Krak! (1996), dass Frauen in der jüngeren Vergangenheit nur geringe Chancen hatten, als Schriftstellerin im karibischen Raum anerkannt zu werden: „Writing […] was an act of indolence, something to be done in a corner when you could have been learning to cook. […] No, women like you don´t write. They carve onion sculptures and potato statues. They sit down in dark corners and braid their hair in new shapes and twists in order to control the stiffness, the unruliness, the rebelliousness. [...] You remember [your mother´s] silence when you laid your first notebook in front of her. Her disappointment when you told her that words would be your life´s work, like the kitchen had always been hers. She was angry at you for not understanding. [...] Writers don´t leave any mark in the world. Not the world where we are from. In our world, writers are tortured and killed if they are men. Called lying whores, then raped and killed, if they are women.” (Danticat 1996: 219-221)
(11) Die Inspiration, die Álvarez aus dem Scheherezade-Mythos bezog, kann durchaus auch mit der Tradition des Storytelling – der Tradition des Erzählens von Geschichten, die Erbe der afrikanischen und damit auch Tradition der karibischen Kulturen ist – in Verbindung gesetzt werden: Zumeist erzählen dabei Frauen fiktive oder reale Geschichten und das Publikum nimmt aktiv am Prozeß des Erzählens teil: „De todos modos, aquí todo es un gran cuento. Todas las tías saben que sus maridos tienen queridas pero se comportan como si no supieran nada. El presidente es ciego pero hace creer que puede ver. Cosas así. Es como una de esas novelas latinoamericanas que en Estados Unidos piensan que es realismo mágico, pero así es como son las cosas en realidad.“ (Álvarez 1998: 269-270) Das Prinzip des Storytelling setzt sich auch in der fragmentierten Narration in How the García Girls Lost Their Accent fort.
(12) „Here they were trying to fit in America among Americans; they needed help figuring out who they were, why the Irish kids whose grandparents had been micks were calling them spics.“ (Álvarez 1991: 135)
(13) Unter den Übersetzungen der Werke von Julia Álvarez ins Spanische sind besonders die Romane De cómo las chicas García perdieron su acento (1994), En el tiempo de las Mariposas (2001), ¡Yo! (1998), En el nombre de Salomé (2002) und Para salvar el mundo (2006) hervorzuheben. Siehe dazu auch das Verzeichnis des literarischen Werks von Álvarez unter http://www.juliaalvarez.com/about/publications.php (07.02.2008)
(14) Modarressi 1992: 9, zit. nach Naficy 2001: 23-24.
(15) In ¡Yo! setzen sich diese Merkmale fort.
(16) Wie Rubenstein betont, ist die inhärente Klage über den Verlust von vergangener Zeit, Raum und Kultur, wie es Álvarez in How the García Girls Lost Their Accent thematisiert, gleichzeitig auch eine Art von Proust´scher Nostalgie, die mit dem Verlust der Kindheit gleichgesetzt werden kann (Rubenstein 2001: 76). Aus diesem Grund setzt sich auch in ihrem Essay Something to declare die Frage danach fort, wie sich ihr Leben entwickelt hätte, wenn sie in der Dominikanischen Republik geblieben wäre: „What would my life have been like if I had stayed in my native country? The truth was I could´t even imagine myself as someone other than the person I had become in English, a woman who writes books in the language of Emily Dickinson and Walt Whitman […] and of the boys throwing stones in the schoolyard, their language, which is now my language.“ (Álvarez 1998: 72)
(17) Mit der Abkürzung „Yo” für Yolanda macht sich Julia Álvarez gleichzeitig die Bedeutung von „Yo” als Personalpronomen im Spanischen zunutze: „Yo” steht daher auch für „Ich”.
(18) Vgl. dazu Álvarez 1991: 80; 107; 137.
(19) Die Kursivsetzungen entsprechen dem Originaltext.
(20) „U’té que sabe”, in Álvarez 1991: 8.
(21) „Life for women in diasporic situations can be doubly painful - struggling with the material and spiritual insecurities of exile, with the demands of family and work, and with the claims of old and new patriarchies. But despite these hardships, they may refuse the option of return when it presents itself, especially when the terms are dictated by men.” (Clifford 1997: 259).
3.4. Literaturen der Migration: Konfrontation und Perturbation als kreativer Impuls
Sektionsgruppen
| Section Groups
| Groupes de sections
For quotation purposes:
Verena Berger: Julia Álvarez – Autobiographische Fiktion und Essay -
In: TRANS.
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. No. 17/2008.
WWW: http://www.inst.at/trans/17Nr/3-4/3-4_berger.htm
Webmeister: Gerald Mach last change: 2010-01-25