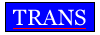 |
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften |
17. Nr. |
Januar 2010 |
|
| Sektion 3.4. |
Literaturen der Migration: Konfrontation und Perturbation als kreativer Impuls
Sektionsleiterin | Section Chair: Ursula Moser (Universität Innsbruck)
Dokumentation | Documentation | Documentation |
La joueuse d’échecs von Bertina Henrichs:
Sprachwechsel und Fremdheit als kreativer Anstoß
Helga Lux (Université de Caen - Basse-Normandie) [BIO]
Email: helga.lux@gmx.net
Die Bedeutung des Autobiographischen beim Schreiben in der Fremdsprache
Bertina Henrichs ist eine Schriftstellerin deutscher Muttersprache, die auf französisch schreibt.(1) Sie wurde 1966 in Frankfurt am Main geboren, mit 19 ging sie nach Paris, wo sie Literatur- und Filmwissenschaften studierte und sich in ihrer Dissertation L‘(im)possible abandon: Le changement de langue chez les écrivains exilés (1997) mit Autoren, die im Exil die Sprache gewechselt haben, befasste (René Schickele, Ernst Erich Noth, Klaus Mann, Georges-Arthur Goldschmidt, Vassilis Alexakis, Nancy Huston). Ihr eigener Sprachwechsel war ein radikaler: Als sie beschloss in Frankreich zu bleiben, weigerte sie sich laut eigener Aussage die ersten 10 Jahre ihres Aufenthalts deutsch zu sprechen oder zu schreiben. Sie hat mehrere Drehbücher zu Kurzfilmen(2) auf französisch geschrieben und 2005 ihren ersten Roman, La joueuse d’échecs ebenfalls direkt auf französisch veröffentlicht.
Das erste Werk in der Fremdsprache trägt oft autobiographische Züge, so Bertina Henrichs im Interview(3) und in ihrer Dissertation L‘(im)possible abandon:(4)
Un des aspects les plus importants d’un certain nombre de textes écrits en langue étrangère est leur caractère réflexif. […] Le genre autobiographique se prête le mieux au profond besoin d’évoquer le passage d’une langue à une autre. Le premier texte issu de la double remise en question par l’exil et le changement de langue s’avère par conséquent souvent une autobiographie. (Henrichs 1997, 540)
Im Moment des Übergangs, in dem sich der Schriftsteller beim Schreiben von seiner Muttersprache abwendet, kommt es notwendigerweise zu einer Neudefinition der Identität. Das autobiographische Schreiben hilft den durch den Sprachwechsel verursachten Bruch zu bewältigen und stellt die Kohärenz in der Biographie wieder her, indem es die (u. a. intellektuelle) Herkunft des Schriftstellers erklärt und ihn somit der neuen Sprachgemeinschaft vorstellt. Das erste Werk in der Fremdsprache erklärt seine „Andersartigkeit“ und reiht ihn gleichzeitig ein in eine neue Tradition (Henrichs 1997, 101).
La joueuse d’échecs (2005) ist zwar der erste Roman Bertina Henrichs‘, nicht jedoch der erste Text auf französisch, da sie den Sprachwechsel bereits in ihrer Dissertation und in den Drehbüchern praktiziert hat. Er liegt also bereits einige Jahre zurück und wurde in ihrer Dissertation zu eben diesem Thema intensiv „aufgearbeitet“. La joueuse d’échecs ist auch kein autobiographischer Roman im eigentlichen Sinn, Bertina Henrichs erzählt nicht von ihren eigenen Erfahrungen, sondern von einem griechischen Zimmermädchen, das eines Tages beschließt, Schachspielen zu lernen. Auf den ersten Blick hat die Geschichte der Schachspielerin also wenig mit der Emigration oder dem Sprachwechsel der Autorin zu tun. Der Roman spielt nicht in Frankreich, sondern in Griechenland, er handelt nicht vom Erlernen einer Fremdsprache, sondern vom Schachspiel, und erzählt nicht vom Auswandern oder großen Reisen. La joueuse d’échecs kann aber bei genauerem Hinsehen bzw. mit genügend Distanz durchaus als die Geschichte eines Sprachlernprozesses und die Erfahrung von Isolation aufgrund einer fremdsprachigen Umgebung gelesen werden.
Die Fremdsprache als Schreibsprache
In ihrer Dissertation L‘(im)possible abandon: Le changement de langue chez les écrivains exilés liefert Bertina Henrichs selbst den theoretischen Hintergrund für den Sprachwechsel:(5) Sprachwechsel bedeutet, dass ein Schriftsteller einen Text in einer anderen Sprache als der Muttersprache (d. h. der Sprache, die er als Kind gelernt hat) schreibt. Es handelt sich dabei nicht um Selbstübersetzung:
L’écriture en langue étrangère n’est pas une traduction intérieure. La langue maternelle coexiste avec la langue étrangère, mais elle n’intervient pas directement dans l’écriture. Elle peut fonctionner plutôt comme une instance de contrôle ultérieure. L’écrivain bilingue est marqué par le fait de se situer lui-même entre deux langues et deux cultures. Il a conscience de la relativité de l’univers linguistique et culturel dans lequel il se place au moment de l’écriture, mais il ne passe pas par sa langue maternelle pour écrire son texte en langue étrangère. (Henrichs 1997, 52)
Der Text wird direkt in der Fremdsprache „gedacht“/ entworfen, die Muttersprache bleibt höchstens als „Kontrollinstanz“ im Hintergrund präsent. Die verschiedenen Sprach- und Kultursysteme beeinflussen die darin behandelten Inhalte: Der Schriftsteller würde in seiner Muttersprache möglicherweise nicht das Gleiche schreiben oder nicht auf dieselbe Weise ausdrücken.
Als Schriftsteller die Sprache zu wechseln, ist nicht nur aufgrund der Schwierigkeit der Sprachbeherrschung kein selbstverständlicher oder „harmloser“ Akt, sondern verbunden mit Brüchen in der Identität, mit Einschränkungen, aber auch mit Befreiung und Bereicherung der Sprache und der Persönlichkeit.
Der Sprachwechsel als Einschränkung und Befreiung
Schreiben und schöpferischer Umgang mit Sprache setzt sowohl in der Muttersprache als auch in der Fremdsprache ein hohes Niveau an Sprachbeherrschung voraus. Die Fremdsprache wurde nicht als Kind, sondern erst später im Leben gelernt, meist in Folge einer Emigration. Es gilt Wortschatz, Grammatik, den richtigen Ausdruck, das richtige Sprachniveau, Konnotationen, Assoziationen und Kulturwissen zu erwerben. Da wo die Muttersprache natürlich und geradezu unbewußt fließen würde, kann die erhöhte Konzentration auf die sprachtechnische Seite in der Fremdsprache zu Einschränkungen im Text führen.
Für einen Schriftsteller stellt die Sprache zudem sein Arbeitsinstrument dar, er will sie nicht nur möglichst in allen Nuancen beherrschen, sondern auch erneuern und bereichern. In der Muttersprache hat der Schriftsteller große Freiheit, er kann die Grammatik beugen, die Wörter verdrehen, ohne dass jemand an seiner Sprachbeherrschung zweifeln würde. Das Schreiben in der Fremdsprache hat aber oft gerade wegen der geringeren Sprachsicherheit Hyperkorrektheit in der Sprachverwendung und strenge Anpassung an die traditionelle Sprachnorm zur Folge.
Umgekehrt bleibt der Zugang zur Sprache dadurch, dass der Sinn der Wörter in der Fremdsprache manchmal weniger präzise ist, spielerischer und unbelasteter. Über den Klang der Wörter erhält der Schriftsteller neue, kreative Impulse und schwierige Themen können leichter behandelt werden. Durch den Wechsel zu einer anderen Sprache und den damit verbundenen Bruch mit der Herkunft werden die mit Sprache (und Erziehung) verbundenen Hemmungen, familiäre und gesellschaftliche Tabus aufgehoben. Auch wenn der Sinn der Wörter bekannt ist, bleiben sie genügend abstrakt, um nicht störend zu wirken. Kontrolle und Zensur des Unterbewusstseins sind ausgeschaltet. Der Sprachwechsel wirkt wie eine Befreiung der Gefühle, die der Autor ausdrücken kann, ohne sie gleichzeitig so direkt oder schmerzhaft zu empfinden.
Bruch in der Identität und Möglichkeit der Integration
Die Muttersprache ist die seit der frühen Kindheit gelernte Sprache, daher eng verbunden mit der ersten Bezugsperson (in der Regel die Mutter), die Sprache der Gefühle, der Herkunft, der Identität und somit wichtigster Bestandteil unseres Zugehörigkeitsgefühls. Die Bindung an die Muttersprache ist meist noch stärker als an ein Land und sie bleibt auch erhalten, wenn das Land verlassen wird. Ein Exil stellt (je nachdem wie erzwungen oder freiwillig) in mehr oder weniger hohem Ausmaß eine Krise dar, da ein Individuum die Stabilität der alten Gemeinschaft verliert und sich als Außenseiter in einer neuen (Sprach-)Gemeinschaft wiederfindet. Die eigene Persönlichkeit muss neu definiert werden, was auch die Chance einer Transformation, einer Bereicherung durch eine „zweite“ Identität, die Chance des Zugangs zu zwei bzw. mehreren Sprachen und Kulturen in sich birgt.
Der Sprachwechsel bewirkt einen zusätzlichen, starken Bruch in der Kontinuität, ist aber auch der Versuch der Integration in eine neue Sprachgemeinschaft. Viele Exilschriftsteller thematisieren Herkunft, Identität, Wandel, Durchgangsstadien (Passagen) und nicht zuletzt den Sprachwechsel in autobiographischen oder theoretischen Texten, die in der Fremdsprache verfasst sind.
Bertina Henrichs hat beobachtet, dass es sich beim Sprachwechsel oft weniger um eine Entscheidung für eine Sprache, als um eine Entscheidung gegen die Muttersprache handelt (Henrichs 1997, 542). Viele Schriftsteller, die während des Dritten Reichs ins Exil gezwungen wurden, wechselten die Sprache nicht nur, um sich das Publikum des Aufnahmelandes zu erschließen, sondern auch weil Deutsch die Sprache der Nazis und damit unbenutzbar war. Bei Schriftstellern der neuen Generation, die nicht aus politischen Gründen auswandern, sind persönliche Gründe im Spiel, wohl nicht immer so dramatische wie bei Nancy Huston, die ihre Heimat und ihre Muttersprache verlässt, so wie sie als Kind von ihrer Mutter verlassen worden war
Viele Autoren, die im Ausland die Schreibsprache gewechselt haben, kehren zu einem gewissen Zeitpunkt, meistens nach 15 bis 20 Jahren, wieder zur eigenen Sprache zurück. Alle die von Henrichs in ihrer Dissertation untersuchten Autoren haben früher oder später wieder begonnen, in ihrer Muttersprache zu schreiben (Georges-Arthur Goldschmidt auf deutsch, Vassilis Alexakis auf griechisch, Nancy Huston auf englisch) und bewegen sich nun zwischen den beiden Schreibsprachen hin und her.(6)
La joueuse d’échecs
La joueuse d’échecs erschien bei Liana Levi, einem kleinen engagierten Pariser Verlag, der neben Werken zur Kunst- und Religionsgeschichte hauptsächlich Übersetzungen publiziert. La joueuse d’échecs passt insofern zur Verlagslinie, als er von einer Nichtfranzösin, allerdings als einer der wenigen Romane im Programm, direkt auf französisch geschrieben wurde. Der Roman hat mehrere kleine Literaturpreise von französischen Gemeinden oder Unternehmen sowie den Rolf-Heyne-Debütpreis (Corine) in Deutschland erhalten und war mit ca. 30 000 Exemplaren in Frankreich und über 50 000 in Deutschland ein relativ guter Verkaufserfolg. Er wurde nicht von Bertina Henrichs selbst, sondern von Claudia Steinitz auf deutsch übersetzt, weitere Übersetzungen sind auf niederländisch, italienisch, spanisch, rumänisch und griechisch erschienen, schwedisch und portugiesisch (Brasilien) sind geplant. Caroline Bottaro hat das Drehbuch für eine Verfilmung erstellt, die ab März 2008 mit Sandrine Bonnaire als Hauptdarstellerin und Schauplatz Korsika gedreht wird
La joueuse d’échecs erzählt die Geschichte von Eleni, die auf der griechischen Insel Naxos ein bescheidenes, zufriedenes Leben führt. Sie ist auf der Insel geboren, hat Panis, einen Autowerkstattbesitzer, geheiratet und mit ihm zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Eleni arbeitet als Zimmermädchen in einem Hotel. Eines Tages wirft sie beim Aufräumen im Zimmer eines französischen Touristenpaares die Figur eines Schachbretts um und aus dieser Geste heraus beginnt sie sich für das Schachspielen zu interessieren. In ihrem alten Schullehrer Kouros findet sie einen Verbündeten, der ihr ein Schachbrett besorgt und ihr das Schachspielen beibringt. Das schachspielende Zimmermädchen stößt bei der Inselgemeinschaft auf Unverständnis und Erheiterung, was vor allem zu Konflikten mit ihrem Ehemann führt, der sich lächerlich gemacht fühlt. Eleni lässt sich jedoch nicht beirren und sogar von Kouros zur Teilnahme an einem Schachturnier in Athen überreden, für das er sie in hartem Training gemeinsam mit dem Apotheker Costa vorbereitet. Die Eskapade nach Athen könnte zum endgültigen Bruch mit ihrem Mann führen, wird von diesem aber im letzten Moment positiv umgedeutet, so dass es zur Versöhnung kommen kann.
Schach statt Paris
Bertina Henrichs hat eine von Tradition und Tourismus geprägte griechische Insel als Schauplatz gewählt, aber Frankreich wird insofern zum Auslöser für Elenis Schachleidenschaft, als Eleni für Paris und den Klang der französischen Sprache schwärmt und das Schachbrett, mit dem sie in Berührung kommt, einem jungen, französischen Paar gehört. Der Anstoß dafür, sich für das Schachspiel zu interessieren, entsteht aus einer Abfolge von mentalen Bildern, ausgehend von dem Moment in der Schwebe, in dem Eleni eine Figur auf dem Schachbrett im Zimmer der Franzosen umwirft und zögert, an welchen Platz sie sie zurückstellen soll. Ihre schwärmerischen Assoziationen zu Paris und zur französischen Sprache, Freiheit, Luxus, Sinnlichkeit, werden dadurch, dass das Schachbrett einem französischen Paar gehört, auf das Schachspiel übertragen und kristallisieren sich bei der Idee, ihrem Mann ein Schachbrett zu kaufen, zu einem konkreten Bild: „Cette idée la frôla comme une robe de soirée satinée glisse sur l’épaule nue d’une danseuse dans la lumière scintillante des lustres.“ (Henrichs 2005, 25) Die Gedankenkette folgt keiner rationalen Logik, sondern ist im Gegenteil stark gefühlsmäßig geprägt und bleibt für Eleni selbst unbewusst. Das eigentliche Motiv Elenis für den Kauf eines Schachbretts beruht sogar auf dem Trugschluss, dass alle eleganten Pariser Damen mit ihren Männern Schach spielen würden und sie sich, indem sie ihrem Mann ein Schachspiel schenkt, wenigstens einen kleinen Teil ihres Traums von Paris erfüllt.
Die Parallele zwischen Schach- und Sprachlernen
Bertina Henrichs deutet selbst im Interview La joueuse d’échecs als Parallele zum eigenen Lernprozess der französischen Sprache und der französischen Kultur, mit allen Etappen von der anfänglichen Begeisterung, der Angst, den Fortschritten, aber auch den Momenten der Entmutigung. Eleni ist zuallererst von den Bewegungen der Spielfiguren fasziniert und mag die exotisch klingenden Namen der verschiedenen Eröffnungen und Strategien, die sie von fremden Ländern träumen lassen, muss dann aber immer wieder ihren ganzen Mut zusammen nehmen, um sich mit dem Schachhandbuch auseinanderzusetzen, dessen Partien sie dann später sogar als Vorbereitung für das Schachturnier ohne Schachbrett auswendig lernt - eine extreme Methode, die an die Art erinnert, wie Elias Canetti durch Auswendiglernen einzelner Sätze ohne Buch die deutsche Sprache gelernt hat.(7) Eleni erfährt großen Druck, die Schachfiguren verfolgen sie bis in ihre Träume, das Lernen bereitet ihr Schwindelgefühle, „le vertige de l’apprentissage“ (Henrichs 2005, 120), ein Anklang an die „Schule des Taumels“, als die Cioran die Erfahrung jeder Art von Exil besonders im Anfangsstadium bezeichnet.(8) Was Eleni immer weitermachen lässt, ist ihr neu erwachter Wissensdurst, aber auch eine gewisse Naivität hinsichtlich der Schwierigkeit ihres Unterfangens - und ihr Lehrer Kouros lässt sie so lange wie möglich über dessen Ausmaß im Unklaren, um sie nicht zu blockieren.
Die Erweiterung des Denk- und Bewegungsraumes
Das Abenteuer des Schachspielens ist vor allem ein geistiges, für Eleni wie das Eintauchen in neue, mentale Welten, „cette sensation de plonger dans un autre monde“ (Henrichs 2005, 59), „de basculer dans un autre univers“ (Henrichs 2005, 88). Mit dem Schachspiel lernt Eleni ein Gedankensystem kennen, das ihr über Analogien zu den Bewegungen der Schachfiguren neue Überlegungen zur Rollenverteilung in ihrer eigenen Gesellschaft ermöglicht, etwa die Unersetzlichkeit des Fußvolkes, der Bauern, die sich mit genügend Beharrlichkeit in jede beliebige Figur verwandeln können, oder die große Beweglichkeit der Dame, die als einzige weibliche Spielfigur gleichzeitig die mächtigste ist („cette idée subversive plut à Eleni“, Henrichs 2005, 48). Nicht zuletzt gelangt sie zur Erkenntnis, dass die Schachfiguren nur durch ihr Zusammenspiel funktionieren und sich gegenseitig ergänzen.
Mit der Erweiterung des Denkraumes findet auch eine zunehmende Erweiterung des Bewegungsraumes statt, zuerst mit den Busfahrten zum wöchentlichen Schachtraining und dann mit dem Ausflug zum Schachturnier nach Athen, als Eleni das erste Mal allein die Insel verlässt, die ihr davor noch nie zu klein erschienen ist. Eleni hat sich mit ihrer Neugier einen neue Bewegungsfreiheit erobert, ein Stück Freiraum, der nur ihr allein gehört, „cette évasion clandestine, ce lambeau de vie qui lui appartenait en propre“ (Henrichs 2005, 59). Das Träumen von fremden Ländern und das Denken in Hypothesen ermöglicht es Eleni auch erstmals die Grenzen ihres Lebens in Frage zu stellen, sie überlegt, was aus ihr geworden wäre, wenn sie an einem anderen Ort geboren worden wäre.
Entfremdung durch neue Erfahrungen
Allerdings kann Eleni diese neuen Erfahrungen „l’expérience fondamentale de ces derniers mois“ (Henrichs 2005, 85) mit ihrer Umgebung nicht teilen, einerseits weil ihr die Worte dazu fehlen, um sie zu beschreiben, andererseits weil nur jemand, der selbst ähnliche Erfahrungen gemacht hat, also ein Schachspieler, diese verstehen könnte. Diese Unmöglichkeit der Kommunikation entfremdet sie ihrer Umgebung. Ihr Interesse für etwas völlig Neues bleibt von ihrem Umfeld, nicht nur unverstanden, sondern wird geradezu als Kritik an der bestehenden Ordnung und Zurückweisung derjenigen, die daran festhalten, aufgefasst, wie etwa von ihrer Kindheitsfreundin Katherina: „Katherina prenait sa petite aventure comme un rejet de cet univers dans lequel elles évoluaient depuis toujours et qui, à ses yeux, était immuable, un roc dans la mer Égée.“ (Henrichs 2005, 89)
Das Ver-rücken der Gewohnheiten „habitudes, répétitions et variations“ (Henrichs 2005, 89), für die das Bild des Meeres mit seiner regelmäßigen Abfolge von Ebbe und Flut steht, wird im Laufe des Romans immer wieder mit Verrücktheit gleich gesetzt, am Anfang sogar von Eleni selbst: „Seuls les fous s’aventuraient à lutter contre le ressac de la mer, avait-elle coutume de penser.“ (Henrichs 2005, 14). Die Idee, Schachspielen zu lernen oder am Schachturnier teilzunehmen, erscheint Eleni selbst als der verrückteste Einfall ihres Lebens, aber auf eine leichte Art „une folie vaporeuse […] une folie en forme de petit nuage“ (Henrichs 2005, 114), genauso luftig wie für sie zuerst die französische Sprache geklungen hat, „ce déploiement ailé de danseurs d’opéra“ (Henrichs 2005, 17). Diese Verbindung zu Paris wird noch einmal deutlich, als ihr auf der Rückkehr aus Athen die ganze Tragweite des Begriffs klar wird und sie als Konsequenz ihrer „verrückten“ Handlung den Ausschluss aus Familie und Gesellschaft erwartet: „Folie, pensa-t-elle en ressentant pour la première fois le poids noir du mot qui jusque-là avait toujours eu le goût d’un après-midi de printemps au jardin du Luxembourg.“ (Henrichs 2005, 211) Für ihren Mann ist die Möglichkeit, dass sie den Verstand verloren haben könnte, eine schlimmere Bedrohung, als wenn sie ihn betrogen hätte. Ein Liebesabenteuer gehört noch zum Bereich des Bekannten:„Une trahison amoureuse, même inacceptable, pouvait être nommée.“ (Henrichs 2005, 98) Das, was nicht benannt werden kann, kann nicht integriert werden.
Ausschluss und Integration
Elenis Schachleidenschaft wird als exzentrisch betrachtet, womit sich Eleni im wahrsten Sinne des Wortes „außerhalb des Kreises“ in einer für sie schmerzlichen Außenseiterposition wiederfindet. Für Eleni ist die Erfahrung der Einsamkeit neu, sie begreift überrascht, dass ihre freund- und nachbarschaftlichen Bindungen auf Gewohnheit und räumlicher Nähe beruhen und sie bis auf die Beziehung zu ihrem Mann keine davon bewusst gewählt hat, „aucun désir ne l’avait portée ver l’extérieur“ (Henrichs 2005, 101). Im Gegensatz zu ihrem Schachlehrer Kouros, der unter anderem aufgrund seiner Homosexualität ein „Exilant“ innerhalb der Gemeinschaft ist, steht ihr aber nicht die Welt der Literatur und Künste offen, die Kouros als alternative geistige Heimat gewählt hat und die ihm seine persönliche Freiheit garantiert: „La solitude assumée, c’est la liberté, avait-il décrété.“ (Henrichs 2005, 67)
Die Lösung, die zur Wiederintegration Elenis führt, ist eine positive Umwertung ihres Schachspiels. Es genügt ein Perspektivenwechsel und ihre neuen Fähigkeiten werden nicht mehr als Bedrohung des Gewohnten, sondern als Bereicherung betrachtet, sie hat durch ihre Teilnahme am Schachturnier nicht ihre Herkunft verraten, sondern im Gegenteil die Insel dort würdig vertreten. Stolz auf das Neue statt Ablehnung des Anderen und der Konflikt löst sich von selbst in Luft auf. Die Integration gelingt durch die Anerkennung ihrer Kunst. Am Schluss des Romans schmückt Elenis Mann Panis das Haus mit Girlanden, um ihre Rückkehr zu feiern.
Sprachwechsel und Fremdheit als kreativer Anstoß
Obwohl sich Eleni nicht auf eine reale Reise, sondern „nur“ auf ein mentales Abenteuer begibt, kommt sie durch die neuen, nicht kommunizierbaren Erfahrungen in eine ähnliche Situation wie jemand, der sich durch Emigration in einer fremdsprachigen Umgebung wiederfindet. Sie macht die Erfahrung der Nichtzugehörigkeit, die laut Edward Said das eigentliche Kennzeichen der Exilsituation ist: „Exile is a solitude experienced outside the group.“ (Said 2001, 177) Nicht die Umgebung wird fremd, sondern Eleni, das Exil ist eines innerhalb der eigenen Gemeinschaft.
Interessant ist, dass Bertina Henrichs laut Interview die Parallele zwischen der Geschichte der Schachspielerin und ihrem eigenen Lernprozess der französischen Sprache nicht bewusst war, als sie La joueuse d’échecs geschrieben hat. Erst als ein Journalist sie darauf hingewiesen hat, ist es ihr „wie Schuppen von den Augen gefallen“. Auch wenn sie meint, dass sie wohl in Deutschland letztendlich auch Schriftstellerin geworden wäre, ist für sie persönlich der Sprachwechsel und das Gefühl der Fremdheit Quelle der Inspiration, was sich auch darin zeigt, dass sie die Geschichte der Schachspielerin nicht in Frankreich angesiedelt hat, das für sie nach 20 Jahren Aufenthalt nichts „Exotisches“ mehr hat. Durch die Entscheidung für ein drittes Land, dessen Sprache sie nicht spricht, verschafft sie sich (ähnlich wie bereits beim Sprachwechsel) erneut die nötige Distanz, die laut ihrer eigenen Aussage für die Entfaltung der Fantasie so wichtig ist.
▲
Bibliographie:
- Cioran, E. M.: Avantages de l’exil. In: La tentation d’exister. Paris: Gallimard, 1956. 65-66.
- Henrichs, Bertina: L‘(im)possible abandon: Le changement de langue chez les écrivains exilés. Université Paris 7 - Denis Diderot, 1997 (unveröffentlicht).
- Henrichs, Bertina: La joueuse d’échecs. Paris: Liana Levi, 2005.
- Henrichs, Bertina: Die Schachspielerin, Hamburg: Hoffmann & Campe, 2006. Aus dem Französischen von Claudia Steinitz.
- Lux, Helga: Interview mit Bertina Henrichs. Paris, September 2007 (unveröffentlicht).
- Said, Edward W.: Reflections on Exile. In: Reflections on Exile and Other Literary and Cultural Essays. London: Granta Books, 2001. 173-186.
Fussnoten:
1 Weitere Schriftsteller mit deutscher Muttersprache, die auf französisch schreiben, sind Anne Weber, Martina Wachendorff und Georges-Arthur Goldschmidt. Es gibt aber auch deutschsprachige Schriftsteller, die in Frankreich leben und keinen Sprachwechsel praktiziert haben, wie etwa Peter Handke, Gila Lustiger, Patrick Süskind oder Birgit Vanderbeke.
2 Après coup (dt. Nachträglich), 14 min., 1996, Bouzouki Blues, 26 min., 1999, auf ARTE und Filmfestivals ausgestrahlt. Mon K sur la commode (noch nicht verfilmt).
3 Bertina Henrichs hat sich im September 2007 für diese Arbeit dankenswerterweise für ein Gespräch zur Verfügung gestellt. Das Interview ist unveröffentlicht.
4 Sie bezieht sich dabei auf die Generation der Exilautoren der 1930er Jahre. Bei zeitgenössischen Autoren, die in der Emigration die Sprache gewechselt haben, etwa Nancy Huston, fänden sich die Reflexionen über den Sprachwechsel oft nicht in den Romanen selbst, sondern seien in theoretische Schriften ausgelagert.
5 Die folgenden Ausführungen zum Sprachwechsel rezipieren Henrichs 1997, 14-70.
6 Das Gleiche gilt auch für Anne Weber, die zuletzt auch Bücher direkt auf deutsch (Im Anfang war, 2000, o. Ü., Gold im Mund, 2005, fr. 2006) und dann wieder auf französisch (Chers oiseaux, 2006) geschrieben hat.
7 Diese Methode wird von Bertina Henrichs ausführlich in ihrer Dissertation (1997, 18-20) beschrieben.
8 „Sous quelque forme qu’il se présente, et quelle qu’en soit la cause, l’exil, à ses débuts, est une école de vertige.“ (Cioran 1956, 65-66).
3.4. Literaturen der Migration: Konfrontation und Perturbation als kreativer Impuls
Sektionsgruppen
| Section Groups
| Groupes de sections
For quotation purposes:
Helga Lux: La joueuse d’échecs von Bertina Henrichs: Sprachwechsel und Fremdheit als kreativer Anstoß -.
In: TRANS.
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. No. 17/2008.
WWW: http://www.inst.at/trans/17Nr/3-4/3-4_lux.htm
Webmeister: Gerald Mach last change: 2010-01-25