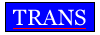 |
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften |
17. Nr. |
September 2008 |
|
| Sektion 7.12. |
Eliten als Orientierungsgeber oder als ‚Sozialschmarotzer’? Zur soziokulturellen Bedeutung von Elitehandeln in gesellschaftlichen Transformationsprozessen
Sektionsleiterin | Section Chair: Jens Aderhold (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und ISInova – Institut
für Sozialinnovation e.V. Berlin)
Dokumentation | Documentation | Documentation |
Österreich-Ungarns Umgang mit den besetzten Eliten des Balkans
während des Ersten Weltkriegs im Vergleich mit aktuellen internationalen Friedensmissionen
Tamara Scheer (Universität Wien) [BIO]
Email: scheer.tamara@gmx.at
„Ihr werdet aufgefordert werden,
mitzuwirken, an dem Wiedererblühen
Eures Vaterlandes“(1)
1. Einleitung
Die Ausführungen behandeln die Rolle der Elite in einer gesellschaftlichen Umbruchsphase, wie sie die Besatzung darstellt. Die Erwartungen, die die Besatzungsmacht an die heimische Elite hat und der Umgang mit ihr sind weitere Aspekte, die behandelt werden. Der geographische und zeitliche Schwerpunkt liegt hierbei bei der österreichisch-ungarischen Militärverwaltung in Montenegro, Serbien und Albanien während des Ersten Weltkriegs.(2) Durch die Berücksichtung der (wissenschaftlichen) Diskussion über internationale Missionen wird die historische Rekonstruktion durch aktuelle (Problem-)Bezüge angereichert.
Der Begriff Elite wird in diesem Zusammenhang jene Bevölkerungsgruppen herausstellen, mit denen die Militärverwaltung unmittelbar zu tun hatte und von denen er bestimmte Verhaltensweisen erwartete bzw. auf die er bei der Erfüllung seiner Interessen angewiesen war. Dies betraf in Fremdherrschaften v.a. die Verwaltungs- (auf allen Beamtenebenen), Bildungs- (Lehrer und Akademiker) und Religionseliten (religiöse Führer, Priester) und zu einem geringeren Teil die Militäreliten. Da Industrien zumeist verstaatlicht, d.h. unter die Aufsicht der Militärverwaltung gestellt wurden, war die wirtschaftliche Elite nicht so sehr von Belang. Die Möglichkeiten von Schriftstellern und Journalisten, sozusagen der „geistigen“ (Meinungsbildungs-)Elite (Intellektuelle), waren durch Zensur und Kontrolle der Medienwelt stark eingeschränkt.(3)
In den bisher von mir zu diesem Thema ausgewerteten Quellen aus dem Ersten Weltkrieg scheint der Begriff „Elite“ übrigens nicht auf. Vielmehr wird er mit die „angesehendsten“ und „einflussreichsten“ Personen umschrieben.
2. Fragestellungen zur Thematik „Umgang mit der besetzten Elite“
A. Welche Interessen verfolgt(e) die Besatzungsmacht im eroberten Gebiet?
Um auf die zentrale Fragestellung, welchen Zweck die Elite für den Besatzer hat, einzugehen, muss zunächst geklärt werden, welche Interessen der Fremdherrscher verfolgte. Darunter fallen öffentlich Kommunizierte, ebenso wie „Verdeckte“. Grundsätzlich galt das besetzte Gebiet zur Zeit des Ersten Weltkriegs als Etappenraum, welchem bestimmte militärische Aufgaben zukamen. Dazu zählte vor allem die Sicherstellung von Ruhe und Ordnung im Rücken der kämpfenden Truppen an der Front, aber auch die Aufrechterhaltung der Versorgung durch Verkehrsverbindungen und Kommunikationslinien. Serbien, Montenegro und Albanien sollten keine Empfänger sein, sondern zu Gebern werden.
Als aktuelles Beispiel wird in simplifizierter Form der Auftrag der International Security Assistance Force (ISAF),(4) der Internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe in Afghanistan wiedergegeben. Dieser unterscheidet sich dadurch von den historischen Beispielen, dass die Elite nicht ersetzt wurde, und daher der Auftrag darin besteht: „Die vorläufige Regierung von Afghanistan bei der Aufrechterhaltung der Sicherheit in Kabul und Umgebung zu unterstützen, so dass die vorläufige afghanische Regierung und das Personal der Vereinten Nationen in einem sicheren Umfeld arbeiten können.“(5)Sicherheit zu garantieren, bleibt allerdings die Hauptaufgabe schlechthin.
B. Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen herrschten vor?
Wie bereits erwähnt, war das besetzte Gebiet Teil des Etappenraums. Es galt daher die Etappenvorschrift.(6) Im Jahr 1913 ausgearbeitet, nahm sie bereits auf die Bestimmungen der Haager Landkriegsordnung Bezug, die Österreich-Ungarn 1909 ratifiziert hatte. Die Organisationsrichtlinien für die Militärgouvernements in Serbien und Montenegro, die so genannten Grundzüge, argumentierten ebenfalls mit der Haager Landkriegsordnung.(7) Hinsichtlich der ansässigen Elite ist v.a. der Artikel 43 zu nennen. Wobei dieser so ausgelegt wurde, dass es zwar zweckmäßig und üblich war höhere Staatsbeamte, Richter und Spitzen einer Provinz bei der Besetzung ihres Amtes zu entheben, was dagegen die Kommunalbeamten betraf: „Von Seiten dieser ist es eine unpatriotische Handlung, wenn sie ihre Stellung aufgeben.“(8)
Heutige Friedensoperationen orientieren sich ebenfalls noch an den Haager Vorgaben, den völkerrechtlichen Regelungen. Daneben sind noch die jeweilige UN-Resolution und die Genfer Konvention zu nennen.
C. Internieren, erschießen, einbinden - Was tun mit der entmachteten Elite?
Österreich-Ungarn hatte in seinen Besatzungsgebieten von vorneherein sämtliche hohen Entscheidungsfunktionen in Verwaltung und Regierung übernommen. Die Etappenvorschrift verfügte jedoch einschränkend: „Falls sich im Feindeslande die Lokalbehörden aufgelöst haben, ist bis zu deren Wiederaufstellung die Verwaltung mit Hilfe der verbliebenen angesehendsten Bewohner zu regeln.“(9) Die Organisationsrichtlinien für die Militärgouvernements in Serbien und Montenegro, die so genannten Grundzüge, sahen ebenfalls lediglich eine Belassung der Gemeindeverwaltung vor. Zumindest in Montenegro wurden ehemalige Minister bei Bedarf zu Beratertätigkeiten herangezogen.(10) Im „befreundeten Albanien“ wurde versucht, auch hohe Verwaltungspositionen mit verdienten angesehenen Persönlichkeiten (Notabeln(11)) und Stammesführern zu besetzen.(12) Am besetzten Balkan war das österreichisch-ungarische Militär aber ohnehin weniger mit der Frage beschäftigt, was mit den ehemaligen Eliten geschehen soll. Vielmehr sah es sich vor die Tatsache gestellt, dass kaum noch ehemalige (Führungs-)Eliten (v.a. in Serbien) im Land verblieben waren.(13)
Was war mit jenen, die nicht mitarbeiteten? Tausende Serben und Montenegriner wurden auf dem Gebiet der Donaumonarchie interniert.(14) Viele von ihnen waren Ärzte und Lehrer und somit ein Teil der Bildungselite der besetzten Staaten. Trotz oder aufgrund der vielen Wegsperrungen versuchte das Armeeoberkommando zu Beginn der Besatzung eines zu verdeutlichen: „Staatliche Funktionäre und Mitglieder der Gemeindebehörden sind [...] nicht zu internieren, vielmehr für das Weiterfunktionieren der militärischen Verwaltung im montenegrinischen Gebiet auszunützen,“(15) ausüben. Einerseits solltenStammeshäuptlingezu Mitarbeitern „herangezogen“ werden, ihre Ämter aber nur unter der ständigen Beobachtung eines „Vertreters der Monarchie, der ein genauer Kenner der dortigen Verhältnisse sein müsste“.(16)
Auf der Homepage des österreichischen Landesverteidigungsministeriums finden sich Lehrunterlagen für militärisches Personal, das in den Auslandseinsatz geschickt wird. Zum Beispiel Afghanistan enthält es auch Rollenspiele. Eines umreißt eben jene schwierige Fragestellung, wie mit der entmachteten Elite zu verfahren ist: „Einige der vorgestellten politischen bzw. militärischen Führer sind durch ihre Rolle in den vergangenen Kriegen kompromittiert, können sich aber auf die Unterstützung ihrer Soldaten, ihrer Clans oder ihrer ethnischen Gruppe verlassen. Welche Möglichkeiten sehen Sie, diese in den Friedensprozess zu integrieren oder daraus zu entfernen, ohne seinen Erfolg zu gefährden?“(17) Bei modernen Friedensoperationen gilt, dass selbst schlechte einheimische Entscheidungen und Handlungen besser sind, als wenn sie vom Besatzer übernommen werden.(18)Als Alternative steht in derartigen Situationen zumeist das Schreckgespenst einer „endlose[n] Militärokkupation“ ohne Möglichkeit der Übergabe in einheimische Hände im Raum.(19)
Im aktuellen, wie im historischen Fall gilt: War die Elite nicht geflohen, so konnten die Verbliebenen zumindest jene drei Kriterien, die für den Besatzer von ausschlaggebender Bedeutung gewesen wären, nicht erfüllen: konstruktiv, fähig und im Besatzersinne arbeitend.(20)
D. Wer blieb (bleibt) im besetzten Gebiet zurück und warum?
Im besetzten Land zurück blieb zum Großteil die weibliche Elite. Die Ehefrauen, Mütter und Töchter der Ärzte, Politiker und anderer führender Persönlichkeiten.(21) Im Land „übriggeblieben“ waren auch pensionierte Staatsdiener oder Personen, die aufgrund ihrer Untauglichkeit nicht zur Armee einberufen worden waren. Für den Unterhalt dieser Rentner musste die Militärverwaltung ebenso aufkommen, wie für die zurückgebliebenen Familien der Soldaten. Hugo Kerchnawe, Generalstabschef des Militärgeneralgouvernements Serbien über die Zahlungen: „Diese Maßregel trug wohl nicht wenig zur Sanierung des Landes bei, schützte sie doch weite Kreise der Intelligenz vor äußerster Not und Verarmung und half dadurch, Elend, Prostitution und Tuberkulose besser zu bekämpfen als manche noch so gut gemeinte Verordnung.“(22) Derselbe gestand aber ein, dass diese Übernahme „eine Last [war], der kein materieller Einnahmeposten gegenüberstand, kaum ein moralischer. Denn, wenn die Betroffenen die Gabe auch willig annahmen, so fühlten sie sich doch durch sie in keinerlei Weise moralisch verbunden, verpflichtet oder auch nur gehemmt.“(23)
E. Warum wurde (wird) schließlich doch eher versucht, die Bevölkerung einzubinden?
Auf Dauer, und das traf auf Österreich-Ungarn ebenso zu, wie heutzutage, sei es im Irak, Afghanistan oder Bosnien, kann ein Besatzer die Verwaltung eines Landes ohne umfangreiche Hinzuziehung der Bevölkerung nicht aufrecht erhalten. Dies ist zum einen zu teuer und zum anderen sehr personalintensiv.(24) Der ehemalige Direktor des Österreichischen Kriegsarchivs, Oskar Regele, ging auf diese Problematik ebenfalls ein: „An sich produktive Länder sind imstande, die eigene Wirtschaftslage zu heben, sobald sie aber einen umfangreichen Verwaltungsapparat […] und viele Besatzungskräfte erfordern, dann können sie unter Umständen eine Belastung bedeuten und den Kampffronten Kräfte entziehen.“(25) Eine lang andauernde Ausschaltung des einheimischen Elements birgt noch weitere Probleme. Über kurz oder lang schafft sie eine unzufriedene entmachtete Bevölkerung, die sich zwangsläufig gewaltsam gegen den Besatzer auflehnt. Oder, wie es Brigadier Walter Feichtinger über das internationale Konfliktmanagement formulierte: die „Meinung schwingt um“ und die UNO-Soldaten, „werden nicht als Befreier sondern als Besatzer gesehen“.(26)
F. Wie wurde (wird) der Einfluss der neuen Elite in der Bevölkerung stabilisiert?
Gezielte PR- und Öffentlichkeitsarbeit war gefragt. Österreich-Ungarn verfasste Proklamationen(27) und belobigte zivile einheimische Arbeitskräfte bei der Militärverwaltung in den Amtsblättern.(28) In Afghanistan wurden sogar Projekte im Namen einheimischer Provinz- und Distriktsgouverneure durchgeführt, obwohl diese gar nicht von ihnen stammten. Dies um einerseits deren schlechte Reputation in der Bevölkerung, aber auch jene der US-Truppen, zu verbessern.(29)
G. Kann (konnte) Besatzung als Konstruktionsraum für Elite verstanden werden?
Dass Elite nicht über Nacht entsteht, sondern ihm ein langsamer Transformationsprozess vorausgeht, dessen war man sich auch im Ersten Weltkrieg bewusst. Österreich-Ungarn führte Verwaltungskurse für Beamte, ebenso ein, wie in Albanien eine Offiziersausbildung.(30) Jeweils besonders gute Schüler und Aspiranten konnten die Möglichkeit erhalten, von der Militärverwaltung finanziell unterstützt zu werden. Albaner von „entsprechender Vorbildung und guter Herkunft“ konnten auf Wunsch ihrer Eltern auf Staatskosten in k.u.k. Kadettenschulen eingeteilt werden.(31) Durch bildungspolitische Maßnahmen (Bau von Gymnasien, Vergabe von Stipendien) sollte eine neue staatstragende Bildungsoberschicht geschaffen werden, die sich dem Besatzer gegenüber loyal verhielt.(32)
Veränderungen erfuhr und erfährt insbesondere die Rolle der Frau in besetzten Gebieten. Besonders den gut ausgebildeten und meist aus höheren Klassen Stammenden wurde die Möglichkeit geboten in Serbien und Montenegro, unterschiedlichste Berufsfelder zu bekleiden.(33) Neue Perspektiven ermöglichte auch die Verfassung Afghanistans aus dem Jahr 2004, die auf Druck der internationalen Gemeinschaft ausgearbeitet worden war. Für das „Haus des Volkes“ der Nationalversammlung muss seitdem jede Provinz mindestens zwei weibliche Delegierte stellen.(34)
H. Was tun, wenn die Elite nicht den Erwartungen des Besatzers entsprach (entspricht)?
Nicht selten sah sich die österreichisch-ungarische Militärverwaltung veranlasst, einzelne einheimische Repräsentanten ihres Amtes zu entheben. Neben der politischen Unzuverlässigkeit, musste die Militärverwaltung gegen Korruption, Unterschlagung und ungerechtfertigte Bereicherung vorgehen.(35) Als ein serbischer Ortsvorsteher Salz zurückhielt, anstatt es an die Gemeindemitglieder zu verteilen und auf eigene Rechnung verkaufte, wurde er wegen Amtsmissbrauch bzw. Veruntreuung gerichtlich verurteilt.(36) Und auch über die Entwicklung Afghanistans und die Qualität seiner Beamten, äusserte sich Markus Gauster: „Der Demokratisierungsprozess verläuft demnach nur sehr langsam. Viele hohe und höchste Funktionäre in der Bürokratie und in der Regierung selbst sind in dubiose Geschäfte und/oder Verbrechen verwickelt.“(37)
Um derartigen Fällen vorzubeugen, gleichzeitig aber den Haager Vorgaben, die einen Eid auf die Besatzungsmacht untersagten, Genüge zu tun, ließ die österreichisch-ungarische Militärverwaltung sämtliche zivilen Organe anstelle eines Eides, eine Gelöbnisformel unterzeichnen: „Allen militärischen Befehlen nachzukommen, für das Wohl des Bezirkes (Gemeinde) nach bestem Wissen und Können zu sorgen und nichts wider die k.u.k. Kriegsmacht zu unternehmen.“(38) Die Unterzeichner quittierten gleichzeitig, dass sie in keiner „monarchiefeindlichen“ Vereinigung Mitglied waren bzw. diese unterstützen. Darunter fiel etwa Narodna Odbrana, die nach einem nachrichtendienstlichen Bericht, zu ihren Mitgliedern die angesehendsten Politiker und Persönlichkeiten Serbiens zählte.(39)
I. Wie ist der Umgang mit der „neuen“ Elite nach dem Krieg?
Bei Kriegsende lösten sich die Militärverwaltungen rasch auf. Nur in den seltensten Fällen gelang eine ordentliche Amtsübergabe.(40) Jener Teil der Elite, der sich während der Besatzungszeit gegenüber Österreich-Ungarn ruhig und kooperativ gezeigt hatte, sah sich nach dem Krieg von den Zurückgekehrten mit dem Vorwurf der Kollaboration und des Vaterlandverrats konfrontiert.(41) Besonders schwer hatten es jene Frauen, die sich während der Besatzungszeit mit österreichisch-ungarischen Offizieren angefreundet hatten.(42)
3. Resumé
Nachdem die Fragestellungen anhand historischer Beispiele mit aktuellen Problembezügen verknüpft worden sind, können einige Feststellungen gemacht bzw. Behauptungen aufgestellt werden. Diese scheinen, unabhängig vom Zeit und Raum, systemimmanent zu sein. Einige davon seien abschließend nochmals genannt:
- Während überdurchschnittliche viele Angehörige der Elite mit dem Einzug der Fremdherrschaft ihre Heimat verlassen, bleibt die höhere Geistlichkeit zurück. Aufgrund ihrer Kooperationsbereitschaft wird sie vom Besatzer zu Verwaltungstätigkeiten herangezogen.
- Ohne Hinzuziehung der Bevölkerung kann auf Dauer keine Besatzungsverwaltung erfolgreich und zweckentsprechend aufrecht erhalten werden.
- Da die Militärverwaltung zur Übergabe der Regierungs- und Verwaltungsgeschäfte gut ausgebildetes und in seinem Sinne arbeitendes Personal benötigt, dominiert der Aspekt der Erziehung und Modernisierung die Besatzungspolitik.
- Zusätzlich tritt die Militärverwaltung als wichtiger Arbeitgeber der Region in Erscheinung.
- Die Besatzungsmacht setzt ihre Strategie oftmals gegen den Willen der Bevölkerungsmehrheit durch. Oftmals kommt es zur Unterstützung einer Bevölkerungsminderheit bei der Staatsbildung, wenn diese die Interessen der Besatzungsmacht vertritt.
▲
Fußnoten:
1 Junker Carl / Langrod Rudolf (eds.),
Sammlung der Verordnungen für die unter k.u.k. Militärverwaltung stehenden Gebiete Polens (Wien: 1916), XVI. Aufruf des Generalgouverneurs an die Bevölkerung.
2 Mehr über die Besatzung dieser Länder im Ersten Weltkrieg durch Österreich-Ungarn: When the Fighting Stops: The Austro-Hungarian Experience with Military Government in Occupied Territories during World War I, in: Čaplovič / Stanová / Rakoto (eds.), Exiting War Post Conflict Military Operations (=6th Conference of the Military History Working Group The Partnership for Peace (PfP), Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes, Bratislava: 2007), 207-14. Der Aufsatz findet sich auch im Internet: http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/07autredossiers/groupetravailhistoiremilitaire/pdfs/2006-gthm.pdf.
Rumänien wurde bewusst ausgeklammert. Der Grund liegt in der geringen Möglichkeit Österreich-Ungarns auf die Besatzungspolitik Einfluss zu nehmen. Der Verbündete, das Deutsche Reich, prägte die Militärverwaltung in Rumänien. Eine aktuelle Studie befasst sich eingehend mit der Besatzung in Rumänien: Heppner Harald, Im Schatten des „großen Bruders“. Österreich-Ungarn als Besatzungsmacht in Rumänien 1916-1918, in: Österreichische Militärische Zeitung, Heft 3 (2007), 317-322.
3 Handwörterbuch der Sozialwissenschaften. Domänen-Fondswirtschaft (=Bd. 3, Stuttgart: 1961), Stichwort: Elite. Sowie: Kaelble Hartmut, Sozialgeschichte Europas. 1945 bis zur Gegenwart (München: Bundeszentrale für Politische Bildung 2007), 164.
4 Die Homepage der ISAF: http://www.hq.nato.int/ISAF/index.html.
5 www.bundesheer.at/download_archiv/ausle_unterlagen/a_r_aucon_li.pdf.
6 ÖStA/KA/Mil. Impressen, Kt. 493. Etappenvorschrift E-57, Entwurf, Wien 1915.
7 ÖStA/KA/NFA, Kt. 1691. MGG Montenegro, Fasz. k.u.k. Kreiskommando Plevlje, 1915/1916: Organisation und Grundzüge für die Militärverwaltung in den von österreichisch-ungarischen Truppen besetzten Gebieten von Serbien, gültig auch für Montenegro.
8 Artikel 43: „Nachdem die gesetzmäßige Gewalt tatsächlich in die Hände des Besetzenden übergegangen ist, hat dieser alle von ihm abhängenden Vorkehrungen zu treffen, um nach Möglichkeit die öffentliche Ordnung und das öffentliche Leben wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten, und zwar, soweit kein zwingendes Hindernis besteht, unter Beachtung der Landesgesetze.“ Strupp Karl, Das Internationale Landkriegsrecht (Frankfurt am Main: 1914), 100-102.
9 ÖStA/KA/Mil. Impressen, Kt. 493. Etappenvorschrift E-57, Entwurf, Wien 1915.
10 ÖStA/KA/NFA, Kt. 1691. MGG Montenegro, Fasz. k.u.k. Kreiskommando Plevlje, 1915/1916: Organisation und Grundzüge für die Militärverwaltung in den von österreichisch-ungarischen Truppen besetzten Gebieten von Serbien, gültig auch für Montenegro.
11 „Notabeln sind Persönlichkeiten, die zwar allgemeines Ansehen genießen, aber nicht über tatsächliche Macht verfügen oder bestimmenden Einfluss ausüben.“ Handwörterbuch der Sozialwissenschaften. Domänen-Fondswirtschaft (=Bd. 3, Stuttgart: 1961), Stichwort: Elite.
12 Schwanke Helmut, Zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Militärverwaltung in Albanien (1916-1918) (phil. Diss. Wien 1982), 106.
13 Jungerth Michael, Entstehung und Organisation des k.u.k. Militärgeneralgouvernements für Serbien (Belgrad: 1918), 4. Jungerth war Vorstand der politisch-administrativen Abteilung des Militärgeneralgouvernements Serbien. Sowie: Roksandic Julius, Sanitäre Wacht an der Pforte des Orients und Occidents: Kriegs-Sanitäres aus dem k.u.k. Militärgeneralgouvernement in Serbien (Belgrad: 1918), 30.
14 Živojinović Dragan, Serbia and Montenegro: The Home Front, 1914-1918, in: Király, Béla (ed.), East Central European Society in World War I (=War and Society in East Central Europe, Vol. XIX, New York: Social Science Monographs 1985), 248.
15 ÖStA/KA/AOK, Kt. 521. B-Gruppe, Nr. 17, 18.1.1916.
16 Komjáthy Miklos, Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates der Österreichisch-Ungarischen Monarchie (1914-1918) (=Publikationen des ungarischen Staatsarchivs, II. Quellenpublikationen, Bd. 10, Budapest: Akad. Kiadó 1966), 372. Protokoll vom 7.1.1916, Gegenstand: Die Kriegsziele der Monarchie.
17 www.bundesheer.at/download_archiv/ausle_unterlagen/a_e_landesinfo_ab5.pdf.
18 Ignatius David, Zen- oder der Fluch des Irak-Krieges, in: Wiener Zeitung (24. Jänner 2007). Ignatius ist Kolumnist der Washington Post.
19 Ignatius David, Die Schwierigkeit, Kriege zu beenden, in: Wiener Zeitung (29. Juni 2007).
20 Langzitat: „Wenn Verhandlung mit Einheimischen: Kontaktperson muss folgendes mitbringen: able, relevant und significant. Ist schwer zu finden.“ Kühne Winrich (Zentrum für Internationale Friedenseinsätze, Berlin), Vortrag an der Landesverteidigungsakademie Wien im Herbst 2006.
21 Knežević Jovana, War, Occupation, and Liberation: Women’s Sacrifice and the First World War in Yugoslavia (Thesenpapier, zugesandt per E-mail im Sommer 2007), 5.
23 Kerchnawe Hugo, Die k.u.k. Militärverwaltung in Serbien, in: Kerchnawe Hugo (ed.), Die Militärverwaltung in den von den österreichisch-ungarischen Truppen besetzten Gebieten (=Carnegie-Stiftung für internationalen Frieden, Abteilung Volkswirtschaft und Geschichte, Wien: 1928), Militärverwaltung in Serbien, 224, 262.
24 Klep Christ (Roosevelt Academy, Middelburg), Vortrag an der Landesverteidigungsakademie Wien im Herbst 2006.
25 Regele Oskar, Gericht über Habsburgs Wehrmacht: Letzte Siege und Untergang unter dem Armeeoberkommando Kaiser Karls I. – Generaloberst Arz von Straußenburg (Wien: Herold 1968), 134.
26 Brigadier Feichtinger ist Leiter des Instituts für Friedenssicherung- und Konfliktmanagment an der Landesverteidigungsakademie Wien. Feichtinger Walter, Vortrag anlässlich der Buchpräsentation im Herbst 2006: Feichtinger Walter / Jureković Predrag, Internationales Konfliktmanagement im Fokus: Kosovo, Moldova und Afghanistan im kritischen Vergleich (Baden-Baden: Nomos 2006).
27 ÖStA/KA/AOK, B-Gruppe, Kt. 512, Nr. 41732, 9.6.1917. Chef des Generalstabs an XIX. Korpskommando Skutari über die Gründe zum Abwurf einer Proklamation an die Albaner.
28 ÖStA/KA/NFA, Kt. 1628. MGG Serbien, Fasz. MGG Befehle, Nr. 112, 11.8.1918.
29 Gauster Markus, Konflikttransformation und Staatsbildung in Afghanistan, in: Feichtinger Walter / Jureković Predrag, Internationales Konfliktmanagement im Fokus: Kosovo, Moldova und Afghanistan im kritischen Vergleich (Baden-Baden: Nomos 2006), 211.
30 „Der mit 21.5. errichtete albanische Offiziersaspirantenkurs in Skutari (Reserveoffiziersschule) mit einem Stand von 27 Frequentanten endet mit 31.10.1917, zwecks weiterer militärischer Ausbildung und auch Vervollkommnung in der deutschen Sprache beantragt das Korpskommando, diese Frequentanten zur Besichtigung des Kriegsschauplatzes an der SW-Front in der Dauer von einigen Tagen zuzulassen.“ ÖStA/KA/AOK, Kt. 512, B-Gruppe, Nr. 43963, 1917. XIX. Korpskommando an AOK, 8.8.1917.
31 Kerchnawe, Militärverwaltung in Montenegro und Albanien, 291.
32 Peters Marc Stefan, Stefan Freiherr von Sarkotić und die südslawische Frage in der Donaumonarchie. Österreich-Ungarns letzter Kommandierender General und Landeschef von Bosnien-Herzegowina als politischer Offizier im Ersten Weltkrieg (phil. Diss. Wien 2005), 43.
33 Knežević Jovana, War, Occupation, and Liberation: Women’s Sacrifice and the First World War in Yugoslavia (Thesenpapier, zugesandt per E-mail im Sommer 2007).
34 Gauster Markus, Konflikttransformation und Staatsbildung in Afghanistan, in: Feichtinger Walter / Jureković Predrag, Internationales Konfliktmanagement im Fokus: Kosovo, Moldova und Afghanistan im kritischen Vergleich (Baden-Baden: Nomos 2006), 222.
35 ÖStA/KA/NFA, Kt. 1676. MGG/S, Fasz. Abschnittskommando Banjica, Befehl Nr. 36, 6.2.1916.
36 ÖStA/KA/NFA, Kt. 1674. MGG/S, Nr. 106, 11.3.1918.
37 Gauster Markus, Konflikttransformation und Staatsbildung in Afghanistan, in: Feichtinger Walter / Jureković Predrag, Internationales Konfliktmanagement im Fokus: Kosovo, Moldova und Afghanistan im kritischen Vergleich (Baden-Baden: Nomos 2006), 229.
38 San Nicolo Mariano, Die Verwaltung Albaniens durch die k.u.k. Truppen in den ersten zwei Jahren der Besetzung des Landes an der Hand der ergangenen Befehle (Wien: 1918), 6.
39 ÖStA/KA/NFA, Kt. 1630. MGG Serbien, Nachrichtenabteilung, Fasz. 633/1916.
40 Scheer Tamara, When the Fighting Stops: The Austro-Hungarian Experience with Military Government in Occupied Territories during World War I, in:Čaplovič / Stanová / Rakoto (eds.), Exiting War Post Conflict Military Operations (=6th Conference of the Military History Working Group The Partnership for Peace (PfP) Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes, Bratislava: 2006).
41 Corni Gustavo, Die Bevölkerung von Venetien unter der österrreichisch-ungarischen Besetzung 1917/18. In: Zeitgeschichte 17, H. 7/8 (1989/90), 314f.
42 Die Historikerin Jovana Knežević widmete dieser Fragestellung einen Großteil ihres Vortrags: Knežević Jovana, War, Occupation, and Liberation: Women’s Sacrifice and the First World War in Yugoslavia (Thesenpapier, zugesandt per E-mail im Sommer 2007).
▲
7.12. Eliten als Orientierungsgeber oder als ‚Sozialschmarotzer’? Zur soziokulturellen Bedeutung von Elitehandeln in gesellschaftlichen Transformationsprozessen
Sektionsgruppen
| Section Groups
| Groupes de sections
For quotation purposes:
Tamara Scheer: Österreich-Ungarns Umgang mit den besetzten Eliten des Balkans während des Ersten Weltkriegs im Vergleich mit aktuellen internationalen Friedensmissionen -.
In: TRANS.
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. No. 17/2008.
WWW: http://www.inst.at/trans/17Nr/7-12/7-12_scheer.htm
Webmeister: Gerald Mach last change: 2010-01-26