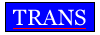 |
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften |
17. Nr. |
September 2008 |
|
| Sektion 7.12. |
Eliten als Orientierungsgeber oder als ‚Sozialschmarotzer’? Zur soziokulturellen Bedeutung von Elitehandeln in gesellschaftlichen Transformationsprozessen
Sektionsleiterin | Section Chair: Jens Aderhold (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und ISInova – Institut
für Sozialinnovation e.V. Berlin)
Dokumentation | Documentation | Documentation |
Das Leistungsprofil politischer Eliten in der Mediendemokratie
Grit Straßenberger (Humboldt-Universität Berlin) [BIO]
Email: grit.strassenberger@sowi.hu-berlin.de
Der öffentliche Elitendiskurs der 1990er Jahre in Deutschland wie die jüngere sozialwissenschaftliche Beschäftigung mit Eliten lässt sich in einem gemeinsamen Paradoxon zusammenfassen: Eliten werden als Lösung eines Steuerungs- und Reformproblems perspektiviert, erscheinen aber zugleich als personifizierter Ausdruck dieses Problems selbst. Anders gesagt: Im Gewande der Elitenkritik formuliert der Elitendiskurs den Bedarf an neuen Eliten. Die alten Eliten haben versagt, weil sie nicht die Leistungen erbracht haben, die von ihnen erwartet wurden, es bedarf daher neuer, leistungsstarker Eliten, die imstande sind, die politischen Herausforderungen besser zu bewältigen. – Aber von welchen Leistungen ist hier eigentlich die Rede? Worin genau besteht das geforderte Leistungsprofil und woran lässt sich ermessen, ob die Eliten die Leistungsanforderungen erfüllen oder nicht?
Diese Fragen verweisen nicht nur auf die Diffusität des öffentlichen Elitediskurses, sondern auch auf ein Defizit der Elitentheorie. Der Leistungselitenbegriff – ob als liberale Versöhnung von Elite und Demokratie via wettbewerbliche Auslese verstanden oder kritisch als ideologische Verschleierung der Reproduktion der herrschenden Klasse bzw. Schicht bezeichnet – bleibt auch in der sozialwissenschaftlichen Reflexion in hohem Maße unbestimmt. So wird das Leistungsprinzip häufig auf die bereichsspezifische Elitenselektion und -rekrutierung bezogen, in der Bewertung der qualitativen Realisierung von Funktionen aber wird Leistung meist mit Erfolg identifiziert, der aber nicht durchweg, wie bereits Hans P. Dreitzel feststellte, auf funktional erbrachter Sachleistung beruht. Damit kollidiert nicht nur das scheinbar objektive Kriterium der Leistungsauswahl mit dem Erfolgsprinzip, sondern es stellt sich die Frage nach der allgemeinen Leistungsdefinition, also der Objektivierung, Bestimmung und Messung von Leistungen.
Mit dem Übergang zur Mediengesellschaft wird die Problematik des Leistungsbegriffs weiter forciert: Gewandelt hat sich, wie Frank Nullmeier betont, nicht das Leistungsprinzip, wohl aber das Verständnis von Leistung: von technisch-sachlicher Leistung, einem Saint-Simonschen und technokratischen Verständnis, hin zum marktmedialen Verständnis von Leistung. Leistung ist nunmehr „all das, was auf Märkten durch Aufmerksamkeitserzeugung für hohe Nachfrage sorgt. Eine Leistung, die nicht bemerkt wird und nicht von anderen durch Nachfrage als Leistung »anerkannt« wird, ist keine Leistung, sondern nur ein privates technisches Kabinettsstück, ein individuelles Privatvergnügen, eine einsame Kunstfertigkeit.“ (Nullmeier 2006: 323f.) Mit diesem Wandel des Leistungsverständnisses in der Mediengesellschaft ist mithin nicht nur eine Ausweitung des Kreises derjenigen verbunden, die Leistungen beurteilen und sich an gesellschaftlichen Definitionsprozessen beteiligen, sondern zugleich werden Erfolg oder Misserfolg auf einem öffentlichen Aufmerksamkeitsmarkt verhandelt, auf dem verschiedene Akteure um das knappe Gut Aufmerksamkeit konkurrieren (Bluhm/Straßenberger 2006: 322).
Für die politischen Eliten stellt die Entwicklung zur Mediendemokratie eine besondere Herausforderung dar: So müssen sie nicht nur mit anderen Akteuren um öffentliche Aufmerksamkeit kämpfen, zugleich steht politisches Handeln unter medialer Dauerbeobachtung. Die Permanenz medialer Evaluierung aber unterminiert die Strategie- und Steuerungsfähigkeit politischer Eliten, die seit Klaus von Beymes Abgrenzung zur politischen Klasse als zentrales Charakteristikum der politischen Elite gilt. Dabei ist die Mediendemokratie mit der Vielzahl derjenigen, die Elitenleistungen beobachten und beurteilen, nur eine Ebene, auf der politische Eliten agieren. Die andere ist die invisible, korporatistische Ebene der Verhandlungsdemokratie.
Wie stellt sich angesichts dieser medialen Verlängerung und Vermarktlichung des politischen Feldes das Leistungsprofil politischer Eliten dar, und welcher Leistungsbegriff ist seiner Beschreibung angemessen? Zur Beantwortung dieser Fragen werde ich zunächst den Leistungselitenbegriff im Dreieck von Leistung, Erfolg und Image problematisieren und kommunikationstheoretisch perspektivieren. Daran anschließend soll ausgehend von einer knappen Skizze der veränderten Rahmenbedingungen für Elitenhandeln in der Mediendemokratie das Leistungsprofil politischer Eliten hinsichtlich seiner subjektiven Voraussetzungen konturiert werden.
Leistung, Erfolg und Image: Leistung als Selbstbeschreibungsformel und gesellschaftlicher Erwartungsbegriff
„Leistungselite“ ist die große liberale Versöhnungsformel von Demokratie und Elite – und damit gleichermaßen gegen die sozialwissenschaftlichen Klassiker der Elitetheorie wie gegen die kritische Elitenforschung gerichtet. Den Klassikern wie den Kritikern ist gemeinsam, dass sie eine strikte Opposition von Demokratie und Elite unterstellen: Danach monopolisiert die Elite einer Gesellschaft in allen Bereichen die Machtpositionen; sie verdankt ihre herausgehobene Position dem Besitz „sozialer Kräfte“, d. h. sie verfügt über gesellschaftlich anerkannte, gewertschätzte Ressourcen, wie Landbesitz, Geld, Titel oder Beziehungen; und sie nutzt ihre Machtposition zum eigenen Vorteil, ist also an einer Reproduktion der Herrschaftsstrukturen interessiert und neigt daher zu Monopolisierung und Vererbung politischer Macht. Sofern hier überhaupt von Leistung die Rede ist, bemisst sich diese allein in der erfolgreichen Behauptung der eigenen Eliteposition. Der Unterschied zwischen Klassikern und Kritikern besteht – recht verkürzt gesagt – darin, dass erstere die Existenz von Eliten gegen demokratische Illusionen politischer und sozialer Gleichheit behaupten, während letztere das demokratische Ideal gegen die faktische Existenz von Eliten stellen bzw. – und genauer – die Existenz von Eliten konstatieren und als Oligarchisierung der Demokratie demaskieren.
Die liberale, pluralistische Elitentheorie unterstellt ebenfalls die Existenz von Eliten, muss aber den Nachweis erbringen, dass demokratische Eliten nicht nur möglich, sondern auch für die Demokratie von Nutzen sind. Der Leistungs(eliten)begriff scheint beiden Anforderungen gerecht zu werden: So unterstellt er einen Zusammenhang zwischen dem wettbewerblichen Ausleseprozess, in dem fachliche Qualifikation und Tüchtigkeit ausschlaggebend für die Besetzung gesellschaftlicher Spitzenpositionen sind, und der qualitativen Realisierung von Funktionen. Dieser Zusammenhang zwischen wettbewerblichem Selektionsmodus und tatsächlicher Leistungserbringung versteht sich jedoch nicht von selbst: Der Wettbewerb prämiert den gegenüber seinen Konkurrenten erfolgreichen Bewerber, ob dieser dann in der Ausübung der erreichten Elitenposition die erforderlichen Leistungen tatsächlich erbringt, ist damit noch nicht sicher gestellt. Die Beurteilung von Elitenleistungen würde nämlich nicht nur das Vorhandensein von verbindlichen Leistungskriterien voraussetzen, sondern auch ein allgemein anerkanntes Messverfahren.
Diese Voraussetzung ist jedoch kaum gegeben. Selbst in Leistungsbereichen, in denen ein allgemein anerkanntes Messverfahren existiert, wie zum Beispiel in der Wissenschaft, sind die Kriterien vielfach umstritten (Hoffmann-Lange 2007: 312). In Politik und Wirtschaft verkompliziert sich das Problem der Objektivierung von Leistungskriterien. „Wer definiert, was Leistung ist, und wer misst auf der Grundlage dieser Definition die Leistung? Die Definitionskompetenz von Leistung“, so Herfried Münkler, „liegt nur im Bereich der Politik – und auch da nur unter demokratischen Konstellationen – bei der Gesellschaft als Ganzes, während in anderen Bereichen der Gesellschaft die jeweiligen Teileliten die Definitionskompetenz selbst besitzen“, die ihnen nur in Ausnahmefällen von anderen Teilen der Gesellschaft streitig gemacht wird (Münkler 2006: 37).
Der seit den 1960er Jahren dominante pluralistische Funktionselitenansatz operiert angesichts dieser Schwierigkeiten mit einem formalen, wertneutralen Leistungsbegriff, der auf den Zugang zu Elitepositionen über Qualifikation (Bildungsabschluss) und beruflichen Erfolg (Alter bei der Besetzung von Führungspositionen) abhebt. Dabei werden qualitative Fragen wie die nach der kompetenten Realisierung von Positionen weitgehend ausgeblendet ebenso wie Werthaltungen und Vorbildfunktion von Eliten. Die Vorteile dieser Formalisierung und Entnormativierung liegen auf der Hand: Die schwierige Frage nach Beurteilung und Messung von Eliteleistungen wird umgangen und die von Beginn an umstrittene Suche nach integrativen Werthaltungen in pluralistischen und hoch individualisierten Gesellschaften in der Figur des tüchtigen Experten aufgelöst. Die Nachteile sind ebenso offensichtlich: Welchen Sinn macht der Begriff der Elite, wenn mit ihm am Ende nur Positionsanalysen vorgenommen werden? Wenn die Differenz zwischen Person und Position verschwindet und mithin die Frage unerheblich wird, ob jemand in erheblichem Ausmaß kraft seiner personellen Fähigkeiten und nicht nur kraft seiner institutionellen Leitungsposition und Binnenvernetzung handeln kann (Mayer 2006: 464), dann ließe sich begrifflich präziser von Führungsgruppen oder Spitzenfunktionären, nicht aber von Eliten sprechen.
Eine zentrale elitentheoretische Annahme, die der funktionalistische Positionselitenansatz ausblendet, der öffentliche Elitendiskurs jedoch revitalisiert, ist, dass Personen Organisationen prägen bzw. dass Eliten nicht nur institutionenkonservativ agieren, sondern über ein Kreativitätspotential verfügen, das insbesondere dann zum Tragen kommt bzw. von ihnen abverlangt wird, wenn die alten Institutionen den neuen Zeiten nicht mehr entsprechen. Was den alten Institutionen an Flexibilität und Innovationskraft fehlt, sollen dann die Eliten aufbringen. Herfried Münkler spricht mit Blick auf diese gesellschaftliche Erwartungshaltung von einer kompensatorischen Position der Eliten und erkennt in der intensivierten Elitenthematisierung ein doppeltes Krisenphänomen: Am Anfang stand das schwindende Vertrauen in die Institutionen, daraus erwuchs eine gesteigerte Aufmerksamkeit für die verschiedenen Teileliten, im Gefolge dieser Aufmerksamkeitssteigerung wurde vermehrt Elitenversagen beobachtet und die Forderung nach neuen – leistungsstärkeren – Eliten aufgestellt (Münkler 2006: 31f.). Der Leistungselitenbegriff ist so betrachtet, ein gesellschaftlicher Erwartungsbegriff – und eine mehr oder weniger erfolgreiche Selbstbeschreibungsformel von Eliten.
Diese diskursive Konstruktion von Elitenleistungen betont auch Frank Nullmeier, wenn er zwischen einem absoluten Leistungsbegriff einerseits und einem relationalen bzw. positionalen andererseits unterscheidet. Leistung in einem absoluten Sinne meint den an einer normierten Messgröße festgestellten Grad der Aufgabenbewältigung. Kennzeichnend dafür ist ein feststehendes Bezugssystem zur Leistungsmessung mit einem zentralen Maßstab oder Kriterium. „Absolut ist dieses Leistungsverständnis jedoch immer nur in Bezug auf einen für alle gleichen Maßstab der Leistungsmessung.“ (Nullmeier 2006: 324) Im Gegensatz dazu nennt Nullmeier ein Leistungsverständnis relativ, wenn es die Leistung im Vergleich mit anderen ausgewählten Akteuren bemisst und bewertet. „Ist in einem absoluten Leistungsverständnis die Sprungweite eines Weitsprunges relevant, so in relativer Sicht, ob dieser Sprung in einem gewählten Vergleichsrahmen (A und B, einzelner Wettkampf) als der weiteste, zweitweiteste, drittweiteste etc. gilt.“ (Nullmeier 2006: 324) Der wettbewerbliche Leistungsbegriff ist ein relativer, er bewertet Leistung über Erfolg, unterscheidet also zwischen Gewinnern, Platzierten und Verlierern, wobei letzteren das Leistungsprädikat auch dann entzogen wird, wenn die absolute Leistungsdifferenz minimal ist, wie Pierre Bourdieu mit Blick auf das französische System des Concour sehr anschaulich gezeigt hat. Der Entzug des Leistungsprädikats auf Seiten der Verlierer – wie der Platzierten – und die Zuerkennung von Leistung auf Seiten der im Wettbewerb Erfolgreichen – Nullmeier spricht hier auch von einem „Positionsgut“ – gewinnt nach Bourdieu nun eine über den Wettbewerb hinausreichende soziale Bedeutung, insofern der Erfolg im Wettbewerb zum symbolischen Gut der Anerkennung wird, das – unabhängig von der im Weiteren tatsächlich erbrachten Leistung – den Erfolg in anderen Funktionsbereichen und Konkurrenzsituationen gewissermaßen prästrukturiert.
Nullmeier greift die Bourdieusche Formel der symbolischen Transformation von relativer Leistung bzw. von Erfolg als prinzipiell knappes Positionsgut in die Attribuierung von Leistung implizit auf, wenn er eine Überblendung der Performanz vom Image konstatiert. „Das Image als Nummer Eins sichert die Position der Nummer Eins. Das kann natürlich bei Fortführung von Performanzmessungen und -vergleichen nur gelingen, wenn die Performanz nicht drastisch absinkt, jedoch ist diese nicht mehr allein ausschlaggebend.“ (Nullmeier 2006: 325) Seine besondere Bedeutung gewinnt das Image vor allem dann, wenn Intransparenz über die absoluten und relativen Leistungen herrscht, weil es an absoluten Maßstäben und an hinreichender Vergleichbarkeit fehlt, wie dies im Falle der Bewertung von Elitenleistungen der Fall ist. Das Image, also die Zuerkennung bzw. Attribuierung von Leistung, schließt dann „die Lücke zwischen dem Wunsch nach hoher Leistung und der Unsicherheit über die zu erwartende Leistungshöhe. Image steht für eine in der Regel erwartbare Leistung. Mangels Überprüfbarkeit anhand Leistungsmaßstäben und Rankings kann sich ein Leistungsimage auch gegen Enttäuschungen längere Zeit halten. Spricht es sich aber herum, dass das Image nicht einlöst, was es verspricht, kann ein rasanter Prozess der Abkehr oder gar Umkehrung des Images einsetzen.“ (Nullmeier 2006: 326).
Auf eine solche Diskreditierung des Leistungsimages verweist der aktuelle öffentliche Elitendiskurs, der den deutschen Funktionseliten unzureichende Leistungsfähigkeit bzw. Erfolglosigkeit in der Realisierung ihrer Positionen attestiert, wobei insbesondere Führungsschwäche bzw. Strategielosigkeit sowie damit verbunden individualistische Werthaltungen und fehlende Vorbildfunktion moniert werden. Im Gewande der Elitenkritik wird hier die Rhetorik einer mit Führungs- und Sozialkompetenz ausgestatteten Leistungselite bemüht, die ein individualistisch-aristokratisches Elitenverständnis reaktiviert, ein Elitenverständnis also, das eine Differenz zwischen Person und Position betont: Während etablierten Organisationen und Institutionen, also adressierbaren Einrichtungen, nur wenig Vertrauen hinsichtlich ihrer Problemlösungsfähigkeiten entgegengebracht wird, figurieren Eliten als zwar umstrittene, aber wirkmächtige (individuelle) Akteure. Entscheidungen von gesamtgesellschaftlicher Tragweite werden nicht Verhandlungsnetzwerken, sondern Personen zugerechnet und die gesellschaftliche Erwartung ist, dass Eliten – und hier insbesondere die politischen Eliten – die Rolle von sichtbaren Entscheidern übernehmen und verantwortungsbewusst und kompetent ausfüllen. – Dabei werden die strukturellen Handlungsbedingungen von Elitenhandeln zumeist ebenso ausgeblendet wie die subjektiven Voraussetzungen für die (langfristig) erfolgreiche Realisierung von Elitepositionen.
Über welche Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale müssen Eliten – und vor allem politische Eliten – also verfügen, um heute erfolgreich agieren zu können? Die strukturellen Bedingungen werde ich im Folgenden unter dem Begriff der Mediendemokratie skizzieren; die subjektiven Voraussetzungen sollen im Rekurs auf den Kompetenzbegriff präzisiert werden.
Das Kompetenzprofil politischer Eliten in der Mediendemokratie
Die Mediendemokratie stellt eine Erweiterung dessen dar, wie Max Weber demokratische Politik konzeptionell fasste, nämlich als Konkurrenz der Parteien um freiwillige Zustimmung zu ihren Angeboten. Seither kann man von einem Wettbewerbs- und Marktmodell der Politik sprechen. Auf diesem Markt wird um Zustimmung von Wählern sowie um Legitimität im weiteren Sinne gekämpft. Zugleich geht es generell um Macht und die Verfügung von umkämpften Ressourcen, wie Ämter und Posten, aber auch Wissen und ideologische Positionen. Heutzutage finden die Kämpfe um Machtressourcen im engeren Sinne und um Stimmen nicht mehr in abgeschotteten Arenen statt, sondern sind in ein größeres Marktgeschehen eingebettet, in dem Wirtschaft, Werbung und andere Systeme um Aufmerksamkeit kämpfen (vgl. Franck 1998). Neue medial präsente Akteure und Akteursgruppen wie Prominente, Lobbyisten, Fundraiser sowie in der Politik agierende Unternehmensberater beeinflussen den Wettbewerb um Ressourcen, Ämter, Posten und Wissen. Angesichts dieser medialen Verlängerung und Vermarktlichung des politischen Feldes muss die Politik darum kämpfen, überhaupt Gehör und Legitimität zu finden; zugleich steht sie bei ihrem Interdependenzmanagement unter Dauerbeobachtung.
Ein Kennzeichen dieser Entwicklung ist, dass es kaum mehr langfristige und inhaltlich anspruchsvolle Parteiprogramme gibt. Gleichzeitig besteht ein besonderer Bedarf an Orientierung und Strategien, um in offenen Situationen Spielräume erkennen und nutzen zu können. Für den Parteienforscher Joachim Raschke resultiert daraus ein Paradox: Strategie sei für die Bewältigung von Problemen und für das Handeln politischer Akteure nötig, in ihrem Kern seien Strategieentscheidungen aber nicht demokratisierbar und könnten als demokratieunverträglich angefochten werden (Raschke 2002: S. 240). In dieser Perspektive stecken die politischen Eliten in einer unkomfortablen Situation: Sie sind gezwungen, mit widersprüchlichen Rollenanforderungen umzugehen und müssen bei abnehmender Strategie- und Steuerungsfähigkeit zumindest mittelfristige Ziele formulieren sowie Umsetzungsprogramme entwickeln. Zudem sind beide an verschiedene Adressaten zu vermitteln, ohne in die Fallen massenmedialer Beobachtung von Politik zu gehen, dass heißt, ohne sich Rolle, Rhythmus und Art von Entscheidungen und Aufmerksamkeit von den Medien vorgeben zu lassen.
Edgar Grande (2000) spricht angesichts dieser Situation von einem „Strukturbruch der Demokratie“: dem Auseinandertriften zwischen einer verhandlungsdemokratischen Ebene, auf der Experten unter Ausschluss der Öffentlichkeit wirken und Kompromisse aushandeln, und einer zweiten Ebene der Mediendemokratie. Hier agieren Politiker und Prominente mit dem Ziel, Mehrheiten zu überzeugen. Entscheidend ist dabei, dass beide Ebenen unterschiedlichen Rationalitäten und Handlungslogiken folgen. Während die Logik der Kompromissbildung in der Verhandlungsdemokratie die Anonymisierung der Beiträge verlangt, erfordert die Logik der Publizität die öffentliche Zuschreibung von Leistungen und die Personalisierung von Erfolgen und Misserfolgen. Für die politischen Eliten bedeutet dieser Strukturbruch, dass sie auf der verhandlungsdemokratischen Ebene faktisch an Gestaltungskraft verlieren, aber in gesteigertem Maße personalisierte Zuschreibungsadresse von Verantwortung und Entscheidung bleiben.
Für Grande liegen die Gründe der medialen Personalisierung in den drei strukturellen Eigenheiten des modernen Politikprozesses: 1) in der personellen, organisatorischen und institutionellen Komplexität des Mehrebenen-Politikprozesses, 2) in der zunehmenden Kompliziertheit politischer Sachfragen in Wohlfahrtsdemokratien und 3) in der prekärer werdenden Wissensbasis. Die damit verbundene Komplexitätssteigerung wurde bislang durch die Legitimationskraft der bestehenden Institutionen, durch deutungs- und sinnstiftende religiöse oder politische Weltbilder sowie durch Vertrauensbildung via wissenschaftliche Expertise geleistet. In dem Maße aber wie diese Kompensationsmodi versagen – durch den Vertrauensverlust in die bestehenden Institutionen der Interessenvermittlung, den Wegfall identitätsstiftender Weltbilder und die Inflationierung und Politisierung wissenschaftlicher Expertise –, wird die Funktion der politischen Komplexitätsreduktion zunehmend von der Person des Politikers übernommen. Die Person des Politikers wird zum Funktionsäquivalent für die „herkömmlichen“ Modi der Komplexitätsreduktion, wie sie Institutionen, Weltbilder und wissenschaftliche Expertise bereitstellten. Es kommt daher zu einer unerwarteten Renaissance des (künstlichen, medial konstruierten und dadurch verstärkten) Charismas.
Grande folgert aus diesem Umstand einen Bedarf an charismatischen Führern und neuartigen Eliten, die in den Doppelstrukturen von Verhandlungsdemokratie und Mediendemokratie wirken können, die die (Medien-)Öffentlichkeit nicht nur nutzen, um ihr Persönlichkeitsprofil und ihre Popularität zu verbessern, sondern sie auch strategisch einsetzen, um ihre Erfolgschancen in der Verhandlungsdemokratie zu verbessern. Über das geschickte Einsetzen des Mediencharismas könnten Einigungsblockaden aufgebrochen und die Leistungsfähigkeit der Verhandlungsdemokratie sogar gesteigert werden. Zugleich aber gibt Grande zu bedenken, dass das Webersche Charisma-Konzept auch Anhaltspunkte für die problematischen Folgen von Interdependenzen zwischen Mediendemokratie und Verhandlungsdemokratie gibt, nämlich das Aufsprengen der bürokratisch-rationalen Herrschaft, der Verhandlungsdemokratie, zugunsten eines populistischen Schürens von Leidenschaften und einer Irrationalisierung der Politik (Grande 2000: 138f.). Der Preis für den Legitimitätsgewinn der Mediendemokratie ist ihr Rationalitätsdefizit.
Will man diesen Preis nicht zahlen bzw. die Kosten des Rationalitätsdefizits minimieren, muss den politischen Eliten einiges abverlangt werden. Um nämlich auf beiden Ebenen erfolgreich, also integrativ, agieren zu können, müssen politische Eliten über unterschiedliche, ja gegensätzliche Fähigkeiten verfügen. Während die Verhandlungsdemokratie Diskretion, Konsensfähigkeit und Kompromissbereitschaft verlangt, sind für die Mediendemokratie „rhetorische“ Fähigkeiten der Zuspitzung und Dramatisierung erforderlich.
Auf das veränderte Leistungssprofil politischer Eliten in der „postkorporatistischen Mediendemokratie“ verweist auch der innerhalb der Soziologie, Bildungsforschung und Psychologie geführte Kompetenz- bzw. Exzellenzdiskurs. Die Liste attraktiver Kompetenzen changiert zwischen Demut und Ehrgeiz, Durchsetzungsvermögen und Teamfähigkeit, Kreativität und Routine, organisatorischer Strategiefähigkeit und Medienkompetenz, wobei die Bündelung von häufig geradezu gegensätzlichen Kompetenzen als Ausweis von Exzellenz gilt (vgl. Henschel 2001; Zimmerli 2001). Dabei verweist insbesondere die vehemente Betonung von performativen, argumentativen, Überzeugung generierenden sowie agonalen Fähigkeiten darauf, dass für den Erfolg weniger genuin fachliche Leistungen entscheidend sind, gefragt ist vielmehr die generalistische Fähigkeit, abhängig vom Handlungskontext mit divergierenden Anforderungen umgehen zu können und Rollenkonflikte zu vermeiden. Die Professionssoziologie thematisiert diesen Zusammenhang auch als „adressatenbezogene Leistungsinszenierung“. Danach ist der Bestand von Professionen maßgeblich daran gebunden, sich auf dem „leistungsbezogenen ‚Erwartungsmarkt’ zu bewegen“. Eine der zentralen Kompetenzen besteht darin, „mehrfach- bzw. vielfach-adressierte Darstellungen geben zu können, die jeweils überzeugen und nicht in Widerspruch zueinander geraten“ (Pfadenhauer 2003: 87).
Das Erfordernis einer „adressatenbezogenen Leistungsinszenierung“ gilt für politische Eliten in besonderem Maße. Sie müssen ihr Handeln unterschiedlichen Bezugsgruppen gegenüber überzeugend vertreten: zuvorderst den Wählern oder der Gesellschaft als Ganzer, die Führungs- und Strategiefähigkeit ebenso erwarten wie Responsivität; sodann der Parteibasis und den Parteifunktionären, deren ideologische wie materielle Orientierungen überzeugend bedient werden müssen; und schließlich den Verhandlungspartnern auf der verhandlungsdemokratischen Ebene pluralistischer Interessenvermittlung. Das Rollenprofil des politischen Spitzenpersonals macht mithin ein Set von geradezu gegensätzlichen Kompetenzen erforderlich: strategisches Handeln, Führungsqualitäten und Fachkompetenz verbunden mit Risikobereitschaft, Mut, Kreativität und nicht zuletzt performativen, argumentativen und Überzeugung generierenden Fähigkeiten. Ein solches Set gegensätzlicher Kompetenzen kann von jetzigen bzw. künftigen Elite-Mitgliedern nicht leicht entwickelt werden – zumal die dem Bildungssystem immanente Trägheit eine rasche Anpassung der Ausbildungsstrukturen an die veränderten Kompetenzprofile verhindert.
Ich komme zu einigen allgemeinen Abschlussbemerkungen:
Worin liegt der analytische Gewinn der Rückbindung des Leistungselitenbegriffs an den Kompetenzdiskurs? Ist der Kompetenzbegriff nicht ebenso diffus bzw. im Fluss wie der Leistungsbegriff? Trotz Skepsis gegenüber dem omnipräsenten „Zauberwort“ Kompetenz (Henschel) liegt dessen Beitrag für den Leistungselitenbegriff zunächst in der stärkeren Akzentuierung der subjektiven Voraussetzungen von Elitenhandeln: Er verweist darauf, dass mit Leistungen von Eliten stets mehr angesprochen ist als die bloße Realisierung von Funktionen, nämlich die Ausdeutung als Rollen, mit denen Fähigkeiten, Wertorientierungen und oft auch ein Ethos verbunden sind. Kompetenz geht mithin nicht in Qualifikation als zertifizierbarer Handlungsfähigkeit auf, sondern ist subjektbezogen und umschließt quasi ganzheitlich viele, verschiedene Handlungsdispositionen (Henschel 2001: 143ff.), die für die erfolgreiche Realisierung von Positionen notwendig sind. Kompetenz verbindet die positionale Zuständigkeit einer Person (Amtskompetenz) mit der Vermutung, dass diese über die dafür erforderlichen Fähigkeiten verfügt. Diese Kompetenzerwartung kann der Positionsinhaber nur dann erfüllen, wenn es ihm gelingt, seine Kompetenz gegenüber verschiedenen Adressaten plausibel in Szene zu setzen, weshalb Ronald Hitzler hier auch von der „Kompetenzdarstellungskompetenz“ spricht.
Damit ist bereits der zweite analytische Mehrwert des Kompetenzdiskurses für den Leistungselitenbegriff angesprochen. Er besteht in der Betonung der Notwendigkeit einer adressatenbezogenen Leistungsinszenierung. Leistung ist zwar der gemeinsame formale Wert, auf den sich unterschiedliche sektorale Eliten berufen, worin genau die Leistungen der Eliten bestehen, was also Eliten voneinander bzw. was die Gesellschaft von ihren Führungsfiguren erwartet, ist gleichwohl nicht ein für allemal festgelegt. Die Forderung gesteigerter Leistungsorientierung ist in der Regel mehr von Vermutungen denn von validen Kompetenzprofilen seitens der Eliten getragen. Darüber hinaus sind die Grundlagen für die Definition von Leistung in modernen Gesellschaften im Fluss. Eine Zweidrittelgesellschaft mit struktureller Arbeitslosigkeit, weniger stetigen Berufskarrieren und zunehmender Notwendigkeit lebenslangen Lernens kann mit dem Leistungsverständnis der klassischen Arbeits- und Berufsgesellschaft kaum noch begriffen werden.
Jenseits substantialistischer Annahmen lassen sich daher Leistungen von Eliten als in Kommunikationsprozessen definierte, wechselseitige Zuschreibungen von Verantwortung seitens verschiedener sektoraler Eliten und Nicht-Eliten begreifen, in denen die Kriterien für Leistungsbewertung wie etwa Kompetenz und Exzellenz, aber auch Prominenz und Prestige deutlich werden. Damit aber variiert das, was jeweils unter Eliteleistungen gefasst wird, sachlich und zeitlich. Eliten werden danach beurteilt, wie sie ihre speziellen Aufgaben bzw. Funktionen wahrnehmen, und danach, ob es ihnen gelingt, ihr Handeln für Bezugsgruppen und Organisationen in unterschiedlichen Kontexten plausibel zu vertreten. Eine derartige Verbindung des Funktions- und Leistungselitenkonzeptes hebt verstärkt auf die diskursive Konstruktion und Formation von Eliten ab.
Die kommunikationstheoretische Perspektive akzentuiert die Abhängigkeit des Elitenbegriffs vom historischen Gesellschaftsbild: Im konkreten Fall der „Berliner Republik“ ist es von einem Umbruch des Sozialmodells bestimmt, nämlich von eklatanten Veränderungen in der sozioprofessionellen Kategorisierung von Lohn-, Gehalts- und Leistungsgruppen, sowie von einer Krise der Repräsentation von Gesellschaft: das Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit der etablierten Institutionen der Interessenvermittlung schwindet – und damit auch das Vertrauen in diejenigen, die dieses System repräsentieren. Insofern eignet sich der Leistungselitenbegriff nicht nur für eine polemische Elitenkritik und ist auch nicht allein Ausdruck einer hysterischen Grundstimmung, sondern verweist auf eine Spannung zwischen gesellschaftlicher Erwartung an und Selbstbeschreibungen von Eliten. Der Leistungselitenbegriff ist so betrachtet, nämlich über den Rekurs auf den die individuellen Voraussetzungen akzentuierenden Kompetenzdiskurs, ein wertkonnotierter Begriff: Er verschränkt Selbst- und Fremdwahrnehmung von Eliten, indem er die positionale Zuständigkeit mit der Ausdeutung dieser Rolle hinsichtlich der Fähigkeiten, Wertorientierungen und ethischen Implikationen verbindet. In diesem Sinne besitzt der Leistungselitenbegriff – verstanden als eine spezifische Variante von Werteliten – ein reflexives Potential: Als Formel gesellschaftlicher Selbstbeschreibung verweist er auf das Bild, das Gesellschaften – bzw. die tonangebenden „Werteliten“ – sich von sich selbst machen: Im Falle der „Berliner Republik“ ist dies offensichtlich nicht mehr die („nivellierte“) Mittelstandsgesellschaft, sondern eine sozial und kulturell polarisierte Gesellschaft, die ihr Wohl einer leistungs- und führungsstarken Wertelite anvertraut.
Literatur:
- Bluhm, Harald/Straßenberger, Grit (2006), Elitenproblematik und die „Berliner Republik“. Diagnosen und konzeptionelle Überlegungen, in: Berichte und Abhandlungen, Bd. 11, hg. v. Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Berlin, S. 315-346.
- Franck, Georg (1998): Ökonomie der Aufmerksamkeit, München: Hanser.
- Grande, Edgar (2000), Charisma und Komplexität. Verhandlungsdemokratie, Mediendemokratie und der Funktionswandel politischer Eliten. In: Leviathan, 28. Jg., H. 2, S. 123-141.
- Henschel, Thomas R (2001), Dialogische Handlungs- und Entscheidungskompetenzen. Welche Bildung brauchen wir für das Wissenszeitalter?, in: Orientierung für die Zukunft. Bildung im Wettbewerb, hg. v. der Alfred Herrhausen Gesellschaft für internationalen Dialog, München/Zürich, S. 137-152.
- Hoffmann-Lange, Ursula (2007), Elitenrekrutierung in Deutschland: Meritokratie oder Mediokrität?, in: Begabt sein in Deutschland, hg. v. Kurt A. Heller und Albert Ziegler, Münster, S. 293-316.
- Mayer, Karl Ulrich (2006), Abschied von den Eliten, in: Deutschlands Eliten im Wandel, hg. v. Herfried Münkler, Grit Straßenberger und Matthias Bohlender, Frankfurt a.M., S. 455-479.
- Münkler, Herfried (2006), Vom gesellschaftlichen Nutzen und Schaden der Eliten, in: Deutschlands Eliten im Wandel, hg. v. Herfried Münkler, Grit Straßenberger und Matthias Bohlender, Frankfurt a.M., S. 25-45.
- Nullmeier, Frank (2006), Wissensmärkte und Bildungsstatus. Elitenformation in der Wissensgesellschaft, in: Deutschlands Eliten im Wandel, hg. v. Herfried Münkler, Grit Straßenberger und Matthias Bohlender, Frankfurt a.M., S. 319-341.
- Pfadenhauer, Michaela (2003), Macht – Funktion – Leistung: Zur Korrespondenz von Eliten- und Professionstheorien, in: Professionelle Leistung – Professionelle Performance. Positionen der Professionssoziologie, hg. v. Harald Mieg und Michaela Pfadenhauer, Konstanz, S. 71-87.
- Raschke, Joachim (2002), Politische Strategie. Überlegungen zu einem politischen und politologischen Konzept, in: Jenseits des Regierungsalltags. Zur Strategiefähigkeit politischer Parteien, hg. v. Frank Nullmeier und Thomas Saretzki, Frankfurt a. M., New York, S. 207-242.
- Zimmerli, Walter Ch. (2001), Wenn sich die Welt ändert, müssen sich die Eliten ändern, in: Universitas, 56. Jg., H. 6, S. 599-609.
▲
7.12. Eliten als Orientierungsgeber oder als ‚Sozialschmarotzer’? Zur soziokulturellen Bedeutung von Elitehandeln in gesellschaftlichen Transformationsprozessen
Sektionsgruppen
| Section Groups
| Groupes de sections
For quotation purposes:
Grit Straßenberger: Das Leistungsprofil politischer Eliten in der Mediendemokratie -.
In: TRANS.
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. No. 17/2008.
WWW: http://www.inst.at/trans/17Nr/7-12/7-12_strassenberger.htm
Webmeister: Gerald Mach last change: 2010-01-26