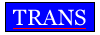 |
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften |
17. Nr. |
Februar 2010 |
|
| Sektion 8.14. |
Gemeinschaft in Differenz: Kollektive Agenten im interkulturellen Kontext / Community in Difference: Collective Agents in Intercultural Contexts
Sektionsleiter | Section Chair: Bertold Bernreuter (Universidad Intercontinental, Mexico City)
Dokumentation | Documentation | Documentation |
Dimensionen von Gemeinschaft – ein Blick auf afrikanische Traditionen
Niels Weidtmann (Tübingen) [BIO]
1. Die Agenten interkultureller Begegnung
Gemeinschaft, so heißt es im Titel dieser Sektion („Gemeinschaft in Differenz: Kollektive Agenten im interkulturellen Kontext“), sei ein „kollektiver Agent“; ihr Agententum soll näherhin untersucht werden im „interkulturellen Kontext“. Dort, so heißt es, steht Gemeinschaft in „Differenz“. Nun wird offen gelassen, ob es Gemeinschaften im interkulturellen Kontext ausschließlich in Differenz gibt; auch wird offen gelassen, ob es im interkulturellen Kontext noch andere Agenten als kollektive gibt. Auch so freilich trifft der Titel eine Aussage, die mehrere Voraussetzungen impliziert, denen ich im Folgenden nachgehen möchte. Ich tue dies in der Hoffnung, damit auf einige grundsätzliche Schwierigkeiten hinweisen zu können, vor die sich eine interkulturelle Begegnung und gar eine interkulturelle Verständigung gestellt sehen.
Multikulturalität
Wenngleich hier nicht näher untersucht werden soll, ob und inwiefern Differenz grundsätzlich konstitutiv für Gemeinschaften ist – es sei freilich darauf hingewiesen, dass gerade die Abgrenzung gegen andere oder anderes immer ein probates Mittel war, lose Gemeinschaften zusammenzuschweißen –, so scheint es doch offensichtlich zu sein, dass verschiedene Gemeinschaften immer in einer Differenz zueinander stehen, und sei sie noch so freundschaftlich und fördernd. Aber, sind Gemeinschaften wirklich Agenten im interkulturellen Kontext? Es scheint doch vergleichsweise selten der Fall zu sein, dass sich ganze Gemeinschaften verschiedener Kulturen begegnen; viel häufiger macht der einzelne die Erfahrung, sich mit einer anderen Kultur auseinander setzen zu müssen. Vor allem aber, und das ist viel entscheidender, gehen wir in der Regel davon aus, dass sich überhaupt nur der einzelne mit einer anderen Kultur auseinandersetzen kann, dass die Begegnung zwischen Kulturen also auch dann, wenn Gruppen aufeinandertreffen, letztlich am einzelnen hängt. Es ist immer der einzelne, so die gängige Überzeugung, der in die andere Kultur eintaucht, sich um ein Verständnis bemüht und möglicherweise Elemente der anderen Kultur übernimmt oder diese umgekehrt durch Elemente seiner eigenen Kultur bereichert (etwa wenn er länger in einer anderen Kultur lebt und dort einzelne Sitten und Gebräuche der eigenen Kultur einführt). Nur deshalb, weil sich der einzelne Mensch jedenfalls grundsätzlich zwischen verschiedenen Kulturen hin und her bewegen kann (auch wenn ihn die Gewohnheit in dieser Hinsicht träge sein lässt), können multikulturelle Wirklichkeiten entstehen. Multikulturell wird die Wirklichkeit nicht dadurch, dass Menschen verschiedener Kulturen bezugslos nebeneinander leben, sondern durch die Integration von Elementen verschiedener Kulturen im Leben des einzelnen Menschen. Multikulturalität basiert wesentlich auf der Differenz zwischen dem Individuum und seiner Kultur.
Transzendentale Ordnungen
Nun, Multikulturalität ist nicht Interkulturalität. Sie übersieht, dass sich Kulturen nicht aus konkreten Sinneinheiten zusammensetzen, zu denen das Individuum Stellung nehmen und auf die es zugreifen könnte, sondern dass sie in erster Linie durch nicht endende Interpretationsprozesse charakterisiert sind. Die einzelnen Elemente einer Kultur (wenn man denn darunter konkrete Manifestationen wie beispielsweise Bau- und Kunstwerke, aber auch einzelne Überzeugungen, Sitten, Gebräuche oder sprachliche Ausdrücke versteht – und das sind ja die Elemente, die im Multikulturalismus synkretistisch zusammengefügt werden sollen), verweisen immer auf einen jeweiligen Sinnraum, den sie zwar zum Ausdruck bringen, der im einzelnen Element einer Kultur aber nicht aufgeht. Das einzelne Bauwerk verweist nicht nur auf eine bestimmte Funktion, sondern bespielsweise auch auf ein bestimmtes Verständnis von Fuktionalität; man spricht deshalb zurecht vom Stil einer Epoche, einer Region, einer Schule, die sich im Bauwerk ausdrückt. Das Gleiche gilt etwa für religiöse Überzeugungen (und noch viel mehr für religiöse Praktiken), auch sie verweisen auf einen religiösen Sinnraum und können nicht isoliert verstanden werden. Überträgt man einzelne Elemente der einen Kultur in eine andere, dann nimmt man ihnen die spezifischen Sinnräume, auf die sie verweisen, und damit eben letztlich auch ihren eigenen konkreten Sinn.
Die verschiedenen Sinnräume lassen sich als Ausdrucksfelder einer Kultur beschreiben, die freilich nicht jenseits der konkreten Ausdrucksformen existieren, sich aber eben auch nicht in einer einzelnen von ihnen erschöpfen und deshalb auch nicht durch die Übernahme einzelner Formen in eine andere Kultur übertragen lassen. Ein Ausdrucksfeld ist so etwas wie die transzendentale Ordnung der verschiedenen Formen, in denen es zum Ausdruck kommt. Anders als in der Transzendentalphilosophie gemeinhin vorausgesetzt, ist die traszendentale Ordnung des Ausdrucksfeldes aber nicht unveränderlich: sie unterliegt geschichtlichem Wandel; nur deshalb kann in einer Ausdrucksform der Stil einer Epoche zur Erscheinung gelangen. Zudem stehen die verschiedenen Ausdrucksfelder einer Kultur nicht unabhängig nebeneinander, sondern befinden sich in fortwährendem Austausch untereinander, ja erhalten ihren eigenen, Raum eröffnenden Sinn erst durch diese Kommunikation, in deren Verlauf sie Entsprechungen untereinander – so etwas wie kulturelle „Grundüberzeugungen“ (Rombach 1985) – ausbilden. Eine kulturelle Gemeinschaft drückt sich zwar im religiösen Feld ganz anders aus als im politischen oder sozialen; völlig unabhängig voneinander sind diese Ausdrucksfelder aber nicht. Die Ausdrucksformen der verschiedenen Felder dürfen sich nicht widersprechen, jedenfalls nicht zu offensichtlich und vehement. Andernfalls wird es zum Streit der transzendentalen Ordnungen kommen, und letztlich werden sich für eine gewisse geschichtliche Spanne einige Ordnngen gegenüber anderen als die führenden durchsetzen. Wenn die Religion das bestimmende Ausdrucksfeld einer Kultur ist (d.h. dieses Ausdrucksfeld im Selbstverständnis einer Kultur einen höheren Stellenwert genießt als andere Ausdrucksfelder) wird das Auswirkungen auf das Feld der Wissenschaften haben – und umgekehrt. Epochenumbrüche lassen sich wesentlich als eine Verschiebung in der Architektonik des Zusammenspiels der verschiedenen transzendentalen Ordnungen einer Kultur verstehen. In Anlehnung an Rombach lassen sich die verschiedenen Ausdrucksfelder deshalb besser als „Dimensionen“ (Rombach 1980, 212 ff.) einer Kultur bezeichnen. Sie stehen nicht nebeneinander, und sie ergänzen sich auch nicht wie in einem Puzzle zur Gesamtkultur. Vielmehr kommt die Kultur in jeder einzelnen Dimension im ganzen zur Erscheinung, nur eben in einer je anderen Perspektive. Die Dimensionen sagen also alle das Gleiche aus, nur tun sie dies unterschiedlich – deshalb Dimensionen von Kultur.
Kulturen sind keine Selbstbedienungsläden – wie es der Multikulturalismus einem gelegentlich vorgaukelt –, und das eben vor allem deshalb nicht, weil die verschiedenen Elemente und Dimensionen einer Kultur in engem Austausch untereinander stehen. Werden sie aus diesem kommunikativen Austausch herausgerissen, dann verlieren sie ihren spezifischen Sinn. Ja, sie werden sinnlos, wenn sie nicht in einen neuen Austausch eingebunden und dabei zwangsläufig auch neu verstanden und verändert werden. Sprache, Geschichte, Religion, ontologische Überzeugungen, Sitten, Gebräuche – all diese verschiedenen Dimensionen einer Kultur sind keine feststehenden Einheiten und verfügen über keinen statischen, quasi essentialistischen Sinn, sondern müssen sich aneinander abarbeiten, einander korrigieren und verändern, damit sie überhaupt so etwas wie eine gemeinschaftliche „Lebenswelt“ (Husserl 1956, s. bes. 105-193) stiften können. Kulturen befinden sich andauernd in einem inneren Kommunikations- und Interpretationsprozess. In eben diesem Prozess gründet die Lebendigkeit einer Kultur. Kommt er zum Erliegen, etwa weil einzelne Dimensionen mit Macht unverändert erhalten werden (beispielsweise im Dogmatismus einer Religion oder einer Gesellschaftsstruktur), dann verliert die Kultur ihre Lebendigkeit. Kulturen sind Kommunikationsprozesse, und nur weil sie das sind, können sie auch in eine Kommunikation mit anderen Kulturen treten.
Gemeinschaft als Agent im interkulturellen Kontext
Die Ebene, auf der der einzelne über ‚seine’ Kultur verfügt, ist dagegen zumeist verdinglicht und deshalb vergleichsweise oberflächlich. Der einzelne kann mit den Ausdrucksformen einer kulturellen Dimension spielen, erfasst diese dann aber gerade nicht als Ausdruck eines lebendigen Kommunikationsprozesses, sondern missversteht sie als an sich sinnvoll seiende Elemente. Auch kann er durch die Manipulation einzelner solcher Elemente die zugrundeliegende Dimension und darüber hinaus das tiefer liegende Entsprechungsgeschehen zwischen den verschiedenen Dimensionen einer Kultur zu beeinflussen versuchen (so etwa auf dem Feld der Politik, aber auch auf allen anderen gesellschaftlich relevanten Feldern), zugreifen kann er auf das sinnstiftende Geschehen nicht. Ob sich die Änderung eines kulturellen Elements durchsetzt und tatsächlich Einfluss auf die Ausprägung der entsprechenden Dimension und der Gesamtkultur nimmt oder nicht, kann nur die Geschichte weisen. Der Multikulturalismus droht deshalb ein reines Oberflächenphänomen zu bleiben und den Sinn für kulturelle Tiefendimensionen zu vernachlässigen.
Will man diese Vernachlässigung vermeiden, taucht unter anderen auch die Gemeinschaft als möglicher „Agent im interkulturellen Kontext“ wieder auf. Sprache, Geschichte, Religion u.a. – all diese Ausdrucksfelder stehen nicht in der Verfügung des einzelnen. Sie bilden sich in einem über zahlreiche Generationen fortlaufenden Prozess innerhalb einer Gemeinschaft von miteinander kommunizierenden Menschen heraus und konstituieren so die gemeinsame Lebenswelt dieser Gemeinschaft. Der einzelne gestaltet die sich ständig verändernde Lebenswelt natürlich immer mit, zugleich übersteigt sie ihn aber unendlich, stellt sie doch so etwas wie den Boden dar, auf dem stehend der einzelne überhaupt erst mitgestalten kann. Wenn sich Kulturen begegnen sollen, müssen also immer auch gemeinschaftliche Dimensionen zum Tragen kommen.
Die oben gestellte Frage wäre also vorläufig so zu beantworten, dass Gemeinschaften sehr wohl Agenten im interkulturellen Kontext sind, wenn auch nicht die einzigen. Auch das Individuum ist ein Agent im interkulturellen Kontext; aber nicht deshalb, weil es sich von Kultur lösen und so zwischen Kulturen vermitteln könnte, sondern gerade weil das Individuum auf dem Boden der transzendentalen Ordnungen einer Kultur steht und deshalb grundsätzlich auf die Gesamtkultur hin ansprechbar bleibt. Bleibt schließlich die Frage danach, was ein kollektiver Agent ist bzw. ob die Gemeinschaft ein solch kollektiver Agent ist.
2. Gemeinschaft und Individuum
Der Mensch ist ein soziales Wesen, d.h. dass er nicht allein lebensfähig ist, sondern anfangs von der Mutter, dann von den Eltern und später von einem größer werdenden Kreis von Mitmenschen versorgt und erzogen werden muss und auch als Erwachsener in eine Vielzahl sozialer Verflechtungen eingebunden bleibt. Er erlernt sein ‚Menschsein’ von und mit anderen Menschen, die ihm seine nähere und fernere Umwelt auf bestimmte Weise, nämlich so wie sie selbst diese verstehen, nahe bringen. Dem heranwachsenden Menschen wird also eine menschlich interpretierte Welt eröffnet und folglich ist schon sein bloßes Umwelterlebnis sozial geprägt. Darüber hinaus sind andere Menschen dem Heranwachsenden Vorbilder, von ihnen lernt er, wie Menschen sich verhalten, wie sie miteinander, mit Tieren, Pflanzen und Dingen umgehen, er übernimmt ihre Sprache, ihre Kleidung, z.T. auch ihre Gewohnheiten usw. Der einzelne wächst in eine menschliche Welt hinein und gewinnt sein Selbstverständnis gerade aus dem Bewusstsein heraus, Teil dieses nicht auf ihn beschränkten, sinnvollen Wirklichkeitszusammenhangs zu sein. „Der fremde Mensch [ist] konstitutiv der an sich erste Mensch“ hat Husserl gesagt (Husserl 1950, 153) und Lévinas hat dies später noch radikalisiert, indem er gezeigt hat, dass der Andere nicht nur für die Intersubjektivität der Wirklichkeit einsteht, sondern durch seinen Anspruch überhaupt erst jenen Raum eröffnet, in den hinein eine Antwort als Mensch möglich ist. Der Anspruch des Anderen ruft den Menschen zum Menschsein auf. Der einzelne bleibt dem Anderen deshalb solange er Mensch ist „ver-antwortlich“, der Andere bleibt uneinholbar. Der Andere ist darum nicht dieser oder jener, vielmehr verweist das „Antlitz“ des Anderen auf eine „Illeität der dritten Person“, die jenseits des Seins steht (Lévinas 1983, 226-235). Der Andere ist bei Lévinas so etwas wie die transzendentale Ordnung von menschlicher Gemeinschaft. Das Primat des Anderen, das damit angedeutet wird, gründet im sozialen Wesen des Menschen – darin, dass der Mensch sich nicht in seinem Selbstsein erschöpft, sondern dieses umgekehrt erst aus dem Entwurf auf eine menschliche Gemeinschaft hin gewinnt.
Lebende Wesen sind grundsätzlich dadurch charakterisiert, dass sie sich nicht darin erschöpfen, das zu sein, was sie sind, sondern über ihre bloße Gegebenheit hinausgreifen, es ihnen um etwas geht, nämlich um sich selbst, um ihre eigene Erhaltung – sie also über sich hinausgehen, um zu werden, was sie sind. Menschen geht es dabei nicht nur um die biologische Selbsterhaltung, sondern um Welt. Menschen sind immer schon auf Welt bezogen, sie sind geradezu das „In-der-Welt-sein“, wie Heidegger sagt (Heidegger 1977). Der Mensch ist nun aber nicht erst Mensch und dann als solcher noch auf Welt bezogen, vielmehr deutet Heidegger einen Strukturzusammenhang an, der besagt, dass der Mensch erst im Entdecken und in der Vereignung von Welt Mensch wird; der Mensch ist das über sich hinausstehende Wesen, er „ek-sistiert“. In der Struktur des In-der-Welt-seins gehören nun nicht nur der einzelne Mensch und die von ihm entdeckte Welt zusammen (wie man bei der Lektüre Heideggers manchmal meinen könnte), vielmehr wird diese Struktur wesentlich von den Mitmenschen geprägt, die Welt bereits vor-entdeckt haben und sie dem einzelnen deshalb auf bestimmte Weise präsentieren.
Freilich hängt der einzelne auch nicht einseitig von den Leistungen der anderen ab, vielmehr werden diese in dem vom einzelnen Dasein eröffneten Weltbezug selber neu und anders interpretiert. Ihnen werden Rollen zugewiesen, die sie bislang so nicht hatten und nicht haben konnten. Jede menschliche Gemeinschaft wird von neu hinzustoßenden Mitgliedern ein bisschen verändert. Manchmal sind dies kaum erkennbare Nuancen oder bloße Stimmungen, ein andermal ist der Wandel offensichtlicher oder gar so grundlegend, dass die Gemeinschaft im ganzen – und mit ihr alle ihre Mitglieder – ein völlig neues Selbstverständnis erhalten.
Die Gemeinschaft prägt den einzelnen, sie hat bestimmte Initiationsriten, anerkennt gemeinschaftliche Regeln und gründet auf geteilten Überzeugungen. Zugleich existiert die Gemeinschaft aber nicht unabhängig von ihren Mitgliedern und wird wesentlich durch deren Interpretation der Riten, Regeln und Überzeugungen konstituiert. Durch diese Kreisbewegung bildet sich nach und nach eine bestimmte Struktur aus, die auf der Entsprechung von Gemeinschaft und Individuen beruht. Die soziale Konstitution des Menschen offenbart sich folglich als ein Prozess, in dessen Verlauf sowohl die Gemeinschaft als auch die Individuen eine eigene Gestalt und ein bestimmtes Profil gewinnen. Gemeinschaft und Individuen sind nicht nur wechselseitig aufeinander bezogen, sondern gehen aus ein und demselben Konstitutionsprozess hervor. Die Spannung zwischen ‘Ich’ und ‘Welt’, zwischen ‘Ich’ und ‘Du’, aber auch zwischen ‘Ich’ und ‘Wir’ ist die Bedingung dafür, dass der Mensch nicht in einem solus ipse gefangen ist, sondern die Möglichkeit hat, Erfahrungen zu machen, zu handeln und dadurch sich selbst überhaupt erst als einen bestimmten Menschen, als ein Ich im Unterschied zu einem ‘Du’ oder ‘Wir’ zu gewinnen. Der einzelne verwirklicht sich in der Weise selbst, in der er mit der Wirklichkeit, in der er steht, umgeht und diese mitgestaltet.(1) Insofern in seine Wirklichkeit dabei immer auch andere Menschen gehören – und sei es nur dadurch, dass er sie meidet oder vermisst – bleibt das Selbstverständnis des Menschen folglich zeit seines Lebens von Gemeinschaften abhängig.(2)
Gemeinschaften sind deshalb nicht eigentlich kollektive Agenten, sie sind keine bloßen Kollektionen von Individuen. Vielmehr ist Gemeinschaft selber eine wesentliche Dimension von Individualität ebenso, wie umgkehrt die Individualität eine Dimension von Gemeinschaft ist. Das Individuum ist immer schon und notwendig, also konstitutiv, gemeinschaftlich; die Gemeinschaft ist immer schon differenziert in Individuen. Individuum und Gemeinschaft zeigen sich uns folglich als verschiedene Dimensionen derselben Wirklichkeit, nicht als verschiedene Größen innerhalb einer Wirklichkeitsdimension. Gemeinschaften sind Agenten im interkulturellen Kontext, nicht aber sind sie kollektive Agenten. Diese Einsicht soll ein Blick auf afrikanische Traditionen verdeutlichen.
3. Ein Blick auf afrikanische Traditionen
Gemeinschaft scheint geradezu ein afrikanisches Phänomen zu sein. Südlich der Sahara leben unzählig viele verschiedene ethnische Gemeinschaften, wobei freilich in vielen Fällen kaum zu entscheiden ist, ob es ich um eigenständige Gemeinschaften oder bloße Untergruppen handelt. Ähnliches gilt für die enorme Sprachenvielfalt in Schwarzafrika. In Afrika gibt es aber nicht nur besonders viele ethnische Gemeinschaften, sie waren in der Vergangenheit auch die zentralen gesellschaftlichen Einheiten, und sie sind es häufig heute noch – trotz Nationalstaat und Afrikanischer Union. Appiah hebt hervor, dass die ethnische Identität niemals einfach der nationalen gewichen ist (Appiah 1992, 158-172). Im Gegenteil, überall dort, wo die nationale Ebene in Konkurrenz zur ethnischen tritt, wird diese mit aller Kraft gegen jede Bevormundung verteidigt. Das geht in einigen Fällen so weit, dass der Staat nur akzeptiert wird, solange er von der eigenen ethnischen Gemeinschaft dominiert oder doch wenigstens stark beeinflusst ist. Wiredu sieht in der Bedeutung von Gemeinschaften sogar das wesentliche Merkmal afrikanischer Kulturen in der Gegenwart: „I think, that the most important [cultural characteristic, N.W.] is the great value placed on communal fellowship in our traditional society.“ (Wiredu 1980, 21f.) Die Bedeutung ethnischer Gemeinschaften wird zudem auf schockierende Weise an den vielen interethnischen Konflikten deutlich, die Afrika in den zurückliegenden Jahrzehnten erlitten hat. Die Ursachen für diese Konflikte sind zahlreich und sie dürfen auf keinen Fall auf die Rolle der Gemeinschaften reduziert werden; dass sie aber zwischen verschiedenen Gemeinschaften ausbrechen, zeigt, wie zentral diese auch heute in den afrikanischen Gesellschaften und Staaten sind.
Ich möchte im Folgenden zu zeigen versuchen, was mit Gemeinschaft in der afrikanischen Kultur gemeint ist. Das soll verständlicher machen, weshalb den Gemeinschaften in Afrika solch große Bedeutung zukommt.
Die Bedeutung der Ahnen für die afrikanische Gemeinschaft
Sowohl die Familie als auch der Clan und die ethnische Gemeinschaft sind in der afrikanischen Vorstellung nicht auf die lebenden Mitglieder dieser Gemeinschaften beschränkt. Vielmehr gehören sowohl die verstorbenen Ahnen als auch die noch ungeborenen Kinder zur Gemeinschaft dazu. Vor allem die Ahnen spielen eine vielfältige Rolle im Leben der Gemeinschaft und beeinflussen deren Selbstverständnis tiefgreifend. Sie werden durch ihren Tod keineswegs unerreichbar, sondern sind durch zahlreiche Beziehungen mit der menschlichen Welt verknüpft.(3) Die Ahnen werden nicht verehrt, sondern sind in dem Maße präsent, in dem sich die Lebenden ihrer eigenen geschichtlichen Herkunft bewusst sind: „The appreciation of what has been received from past generations forms the basis of the excessive reverential attitudes often shown by the African people to their ancestors. This being so, it may be said not only that the whole notion of ancestorship is linked to that of tradition but that the notion of ancestorship becomes more intelligible when it is broadly conceived and associated with that of tradition. The ancestors are the sources of tradition.“ (Gyekye 1996, 164) Die Ahnen nehmen gleichsam jenen Platz in der Welt ein, welchen in Gesellschaften mit Schrifttradition die schriftlichen Überlieferungen innehaben. Die Ahnen repräsentieren die geschichtliche Dimension der Gemeinschaft. Anders als im Fall schriftlicher Überlieferungen, lassen sich die Erinnerung an die Ahnen und das historische Selbstverständnis der Gemeinschaft, also die Interpretation der von den Ahnen überlieferten Zeugnisse nicht trennen. Das Reich der Ahnen ist deshalb auch gegenwärtig und gehört keinesfalls der Vergangenheit an. Darauf beruht die Kraft und Verbindlichkeit der Worte der Ahnen.
Die von den Ahnen und den noch Ungeborenen repräsentierte geschichtliche Dimension ist in Relation zur Gegenwart der lebenden Menschen weder vergangen noch zukünftig. Die Gegenwart stellt eine Konkretion der geschichtlichen Dimension der Gemeinschaft und nicht lediglich einen zeitlich begrenzten Abschnitt in dieser dar. Die von den Ahnen repräsentierte geschichtliche Dimension ist also eine reale, gegenwärtige Erfahrungsebene der Gemeinschaft, kein bloßes Reservoir historischer Fakten.
Tiefere Dimensionen von Gemeinschaft: Geister und Gottheiten
Gemeinschaft ist also in der afrikanischen Kulturwelt nicht, wie üblicherweise angenommen, eine ethnisch begrenzte Einheit, sie ist nicht in erster Linie eine Verwandtschaftsgruppe, sondern eine gelebte Gemeinschaft, die sich auf die verschiedenen Dimensionen ihrer Erfahrung stützt. Das macht vor allem Gyekye deutlich, der deshalb auch von „the invention of ethnicity“ spricht, wenn darunter Blutsverwandtschaft verstanden wird (Gyekye 1997, 96ff.). Es ist wichtig zu unterscheiden zwischen der Realität verwandtschaftlicher Beziehungen, wie sie sich in zahlenmäßig begrenzten Gemeinschaften zu einem gewissen Grad immer ausbilden, und der vermeintlichen Wesensbestimmung afrikanischer Gemeinschaften, auf Blutsverwandtschaft zu gründen, wie das von den Kolonialmächten angenommen wurde und sich bis heute gelegentlich in der Literatur – aber auch im Selbstverständnis afrikanischer Gemenschaften – noch wiederfindet. Tatsächlich ist Letzteres ein veräußerlichendes Missverständnis von Gemeinschaft in Afrika, das während der Kolonialzeit extrem gefördert worden ist (Ranger 1993, 248) und heute z.T. absichtlich beibehalten wird (Kigongo 1992).
Gemeinschaft ist in afrikanischen Kulturen deshalb auch nicht auf die Gemeinschaft von Lebenden und Ahnen beschränkt, sondern umfasst in einer weiteren Dimension auch die Geister. In den Geistern manifestieren sich Erfahrungen von sozialen Kräften, die nicht mehr der eigenen Geschichte zuzuordnen sind: Krankheit, Eifersucht, Neid, Zorn, aber auch Freundschaft, Glück, Gelingen, Können. Die Dimension der Geister wiederum verweist auf eine noch tiefer liegende Dimension von Gemeinschaft, die von den Gottheiten repräsentiert wird.(4) Die zahlreichen Gottheiten stehen für die Erfahrung der Naturkräfte und Naturereignisse. Die von den Gottheiten repräsentierte Gemeinschaftsebene schließlich ist an den Schöpfergott rückgebunden, der nun aber gerade nicht die grundlegendste und abschließende Dimension darstellt, sondern für die Lebendigkeit der Gemeinschaft steht. Der Schöpfergott wird ebensowenig verehrt wie die Ahnen oder die Gottheiten und doch wird er im täglichen Leben der Menschen immer dann erinnert, wenn es um Geburt oder Tod geht.(5) Er repräsentiert die Grundbewegung des Lebens.
Die Gottheiten sind allesamt an eine bestimmte Lebensgemeinschaft gebunden und besitzen keineswegs weiterreichenden Einfluss und werden auch nicht über die betreffende Gemeinschaft hinaus allgemein anerkannt. Sie haben keinen Absolutheitsanspruch. Sie repräsentieren ebenso wie die Ahnen eine Erfahrungsdimension der Gemeinschaft – nämlich diejenige der Naturkräfte. Entsprechend kennt jede einzelne ethnische Gemeinschaft ihre eigenen Gottheiten und verlangt von Fremden nicht, diese Gottheiten ebenso zu achten. Im Gegenteil, es ist ganz selbstverständlich, dass andere Menschen andere Gottheiten kennen. Besonders deutlich ist dies für die Gottheit des Landes: Das Siedlungsgebiet jeder Gemeinschaft hat seine eigene Landgottheit, die zwar über dieses Gebiet die unbedingte Hoheit besitzt, anderen Ländern gegenüber aber völlig gleichgültig bleibt. Die Gottheiten verschiedener Gemeinschaften treten nicht in Konkurrenz zueinander, weshalb es in Afrika südlich der Sahara auch keine ursprünglich religiös bedingten Konflikte gibt. Andererseits bedeutet jede Streitigkeit zwischen Menschen verschiedener ethnischer Gemeinschaften immer auch eine Auseinandersetzung zwischen den entsprechenden Gottheiten. Es gibt zwar keinen Streit um Gottheiten, aber jeder Konflikt ist auch ein Konflikt zwischen Gottheiten.
Afrikanische Gemeinschaften sind durch ihren Bezug zur Dimension der Individualität nicht annähernd erschöpfend beschrieben. In ihnen klingen alle möglichen Erfahrungsdimensionen des Lebens und der Welt an: Die Erfahrung von Natur, Schöpfung, Leben und Tod ebenso wie die Erfahrung von Geschichte, Religion, Sozialität und Individualität. Ihre konkrete Gestalt und ihr eigenes Profil gewinnt eine Gemeinschaft aus der Entsprechung dieser verschiedenen Erfahrungsdimensionen. Im Austausch zwischen diesen Erfahrungsdimensionen, in dessen Verlauf die Entsprechung erst konstituiert wird, lebt die Gemeinschaft, wandelt und erneuert sich.
In den afrikanischen Traditionen stehen Gemeinschaften so sehr im Mittelpunkt des kulturellen Selbstverständnisses, dass alle anderen Dimensionen (Ausdrucksfelder) der Kultur wesentlich von ihrer Bedeutung mitgeprägt sind. Mehr noch: Jede einzelne afrikanische Gemeinschaft kennt ihre eigenen Gottheiten, so wie sie ihre eigenen Ahnen hat (historische Dimension) und ihre eigene Gegenwart lebt. Sie stellt eine Erfahrungswelt in all ihren Dimensionen dar und hat deshalb keinerlei Überschneidungen mit anderen Gemeinschaften. Sie bleibt Außenstehenden gegenüber verschlossen, ohne jedoch einen über ihre eigene Lebenswirklichkeit hinausgehenden Absolutheitsanspruch zu besitzen. Um zu einer Gemeinschaft dazuzugehören, muss man ganz konkret ihre gelebte Gemeinschaftlichkeit teilen.
4. Die interkulturelle Begegnung
Der Blick auf die afrikanische Tradition von Gemeinschaft hat – trotz aller Vorläufigkeit der hier lediglich angedeuteten Analyse – auf die besondere Bedeutung von Gemeinschaft in afrikanischen Kulturen aufmerksam gemacht. Sie steht so sehr im Mittelpunkt des kulturellen Selbstverständnisses, dass alle anderen Dimensionen der kulturellen Lebenswelt von ihrer Bedeutung für die Dimension der Gemeinschaft her interpretiert werden. Besonders deutlich wird das am Beispiel der religiösen Erfahrungen und Überzeugungen, die ihren Sinn in der Tradition afrikanischer Kulturen wesentlich daraus beziehen, Tiefendimension der Gemeinschaft zu sein. Der Vergleich mit anderen Religionsgemeinschaften würde zeigen, dass es sehr viel häufiger anders herum ist: dass nämlich die Gemeinschaft ihren Sinn dadurch erhält, eine gemeinsame Religion zu leben, gleichsam „Höhenstruktur“ (Rombach 1988, 202-216) bzw. Höhendimension von Religion zu sein. Während das eine Mal die Dimension der Gemeinschaft so sehr im Vordergrund steht, dass sich alle anderen Dimensionen auf sie hin ausrichten, orientiert sich die Gemeinschaft im anderen Fall an der religiösen Dimension. Dadurch freilich erhalten die Dimensionen eine ganz andere inhaltliche Bedeutung, ja einen völlig neuen Sinn.
Auch in der westlichen Tradition spielt Gemeinschaft eine wichtige, ja für das Individuum konstitutive Rolle. Auch hier lassen sich religiöse, politische und naturhafte Dimensionen von Gemeinschaft aufweisen. Allerdings kommt der Gemeinschaft keine vergleichbar prägende Rolle im Konzert der kulturellen Ausdrucksfelder zu, wie das in der afrikanischen Tradition der Fall ist. Es ist darum richtiger, von der gemeinschaftlichen Dimension von Religion oder Politik zu sprechen. Um das oben genannte Beispiel aufzugreifen: In westlichen Kulturen (einschließlich der islamischen) wird eher um Götter, richtiger den einen wahren Gott gekämpft denn mit Göttern.
Von hier aus stellt sich abschließend erneut die Frage nach den Agenten im interkulturellen Kontext. Streng genommen begegnen sich interkulturell weder die Individuen noch die Gemeinschaften, sondern die jeweiligen Entsprechungen zwischen den verschiedenen Erfahrungsdimensionen der einzelnen Kulturen. Darin liegt die eigentliche Schwierigkeit der interkulturellen Begegnung: In der Begegnung einzelner Individuen ebenso wie in der Begegnung von Gemeinschaften gelangen die verschiedenen Kulturen nur dann zur Erfahrung, wenn sich die Individuen und Gemeinschaften auf das kulturelle Entsprechungsgeschehen, in dem sie stehen, hin ansprechen. Dieses Entsprechungsgeschehen ist von außen nicht in seiner Eigenart erkennbar, es ist zwangsläufig hermetisch. In der Begegnung der Kulturen kann aber das Entsprechungsgeschehen der eigenen Kultur deutlicher, ja überhaupt erst bewusst werden. Darin liegt die Chance, auf die Lebendigkeit der eigenen Kultur aufmerksam zu werden und sie in ihrer Eigenheit zu begreifen, statt sie als gegeben und universal vorauszusetzen. Das Aufmerken auf die Eigenheit der eigenen Kultur wäre der erste Schritt zur Anerkennung der Eigenheit anderer Kulturen und zum freundschaftlichen Interesse, diese andere Eigenheit auch kennen lernen zu dürfen.
Literatur:
- Kwame A. Appiah (1992): In my father’s house. Africa in the philosophy of culture. Oxford/New York: Oxford University Press.
- Arnold Gehlen (1958): Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt. 6. Auflage. Bonn: Athenäum.
- Kwame Gyekye (1996): African Cultural Values. An Introduction. Philadelphia/Accra: Sankofa.
- Kwame Gyekye (1997): Tradition and Modernity. Philosophical Reflections on the African Experience. Oxford/New York: Oxford University Press.
- Martin Heidegger (1977): Gesamtausgabe Bd.2: Sein und Zeit. Frankfurt/M.: Klostermann.
- Edmund Husserl (1950): Cartesianische Meditationen. Husserliana I. Den Haag: Martinus Nijhoff.
- Edmund Husserl (1956): Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Husserliana VI. 2. Auflage. Den Haag: Martinus Nijhoff.
- James K. Kigongo (1992): „The concepts of individuality and social cohesion. A perversion of two African cultural realities“. In: Albert T. Dalfovo u.a. (Hg.): The foundations of social life. Ugandan philosophical studies I. Washington, S. 59-67.
- Emmanuel Lévinas (1983): „Die Spur des Anderen“. In: Ders.: Die Spur des Anderen. Untersuchungen zur Phänomenologie und Sozialphilosophie. Freiburg: Alber, S. 209-235.
- John S. Mbiti (1974): Afrikanische Religion und Weltanschauung. Berlin: Walter de Gruyter.
- T. Ranger (1993): „The invention of tradition in colonial Africa“. In: Eric Hobsbawm und T. Ranger (Hg.): The invention of tradition. Cambridge.
- Heinrich Rombach (1980): Phänomenologie des gegenwärtigen Bewusstseins. Freiburg/München: Alber.
- Heinrich Rombach (1985): „Völkerbegegnung im Zeichen der Philosophie.“ In: Stadt Meßkirch (Hg.), Heimat der Philosophie. Meßkirch: Druckerei Schönebeck.
- Heinrich Rombach (1988): Die Gegenwart der Philosophie. 3. Auflage. Freiburg/München: Alber.
- Heinrich Rombach (1994): Phänomenologie des sozialen Lebens. Grundzüge einer phänomenologischen Soziologie. Freiburg/München: Alber.
- Kwasi Wiredu (1980): Philosophy and an African culture. Cambridge/London u.a.: Cambridge University Press.
- Hans A. Witte (1991): „Familiengemeinschaft und kosmische Mächte - Religiöse Grundideen in westafrikanischen Religionen“. In: Mircea Eliade (Hg.), Geschichte der religiösen Ideen. Bd. 3 (2): Vom Zeitalter der Entdeckungen bis zur Gegenwart. Freiburg: Herder.
▲
Anmerkungen
1 Es ist deshalb nicht richtig, den Menschen als „Mängelwesen“ zu beschreiben, wie Gehlen dies tut (der Begriff des Mängelwesens ist ursprünglich Herder entlehnt). Nicht nur der Mensch, sondern die menschliche Wirklichkeit im ganzen verlangt, erst noch gestaltet zu werden. Darin liegt nun aber gerade kein Mangel, vielmehr ist darin die Lebendigkeit der Wirklichkeit begründet. Gehlen sieht die transzendentale Notwendigkeit des Mangels nicht und reduziert ihn deshalb auf die tatsächliche Unzulänglichkeit der empirischen Erscheinung des Menschen. Vgl. Gehlen 1958.
2 Während vor allem Heidegger noch ganz auf das Verhältnis Mensch-Welt geht und diese Grundspannung als die Struktur des In-der-Welt-seins beschreibt, bricht Rombach diese Beschränkung auf eine einzige Spannungsebene auf und erkennt die Bedeutung, welche die „sozialen Ordnungen“ für die Konstitution des Menschen spielen. Dadurch daß die Beteiligung anderer Menschen an der Ausbildung einer Struktur betont wird, tritt die Korrekturleistung aller am Strukturationsprozeß beteiligten Momente deutlicher hervor. Das Leben des ‘Menschen-in-der-Welt’ beruht nicht auf einem kreativen „Entwurf“, sondern auf „konkreativer“ Findung. Vgl. Rombach 1994, 153-161.
3 Mir scheint die Unterscheidung, die Mbiti seinerzeit zwischen solchen Ahnen, an die sich einzelne der lebenden Mitglieder einer Gemeinschaft noch erinnern, und anderen Ahnen, die nicht mehr namentlich bekannt sind und nur noch in Legenden und als Teil der undifferenzierten Gruppe ‘der gemeinsamen Vorfahren’ weiterleben, getroffen hat, immer noch nützlich zu sein, auch wenn man seinen grundsätzlichen Überlegungen und Folgerungen heute kritisch gegenüberstehen muss. Die persönlich erinnerten Vorfahren nennt Mbiti „Lebend-Tote“, da sie eine Zwischenstellung einnehmen zwischen den Lebenden und den „Geistern“, während die nicht mehr persönlich bekannten Ahnen reine Geister sind (Mbiti 1974, 32ff.).
4 Während Mbiti von „Gottheiten“ spricht, verwenden andere Autoren die Bezeichnung „Unter-Götter“ („lesser gods“). Auch verschwimmt die Trennung zwischen Geistern und Gottheiten in vielen Darstellungen. Die Anzahl der unterschiedenen Lebensdimensionen variiert deswegen in der Literatur.
Vgl. dazu den Überblick, den Witte über die Gottesvorstellungen in Westafrika gibt (Witte 1991, 232 ff.).
8.14. Gemeinschaft in Differenz: Kollektive Agenten im interkulturellen Kontext / Community in Difference: Collective Agents in Intercultural Contexts
Sektionsgruppen
| Section Groups
| Groupes de sections
For quotation purposes:
Niels Weidtmann: Dimensionen von Gemeinschaft – ein Blick auf afrikanische Traditionen - In: TRANS.
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. No. 17/2008.
WWW: http://www.inst.at/trans/17Nr/8-14/8-14_weidtmann.htm
Webmeister: Gerald Mach last change: 2010-02-06