| Trans | Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften | 2. Nr. | November 1997 |
Nonna Kopystianska (Lviv)
Die ersten Schwierigkeiten bei der Abfassung einer Literaturgeschichte sind mit der Auswahl verbunden: man wählt Materialien nach qualitativen und quantitativen Merkmalen, man wählt Methodik und Struktur. Wenn es sich um nationale Literaturgeschichte handelt, besteht die Schwierigkeit in der Auswahl von Autoren. Welchen Autor man im Allgemeinen darstellen will und welche Autoren dann in einzelnen Kapiteln dargestellt werden. Wer von ihnen zu welcher Periode und Literaturrichtung gehört, welche Werke man als wichtigste in der allgemeinen Literaturentwicklung bezeichnen muß, und welche Werke als typische für einen Autor darzustellen sind.
Zusätzliche Schwierigkeiten entstehen bei der Geschichtsschreibung von Literaturen mehrerer Volker, die aber auf der bestimmten Ebene einen gemeinsamen Ausdruck bilden, sprachlich (z.B. deutschsprachige Literatur), ethnisch, geographisch oder politisch. Von Anfang an besteht die Frage der Terminologie, was zu einer bestimmten Gemeinschaft gehört und was nicht, und wo ihre Grenzen liegen.
So, zum Beispiel, polemisiert man schon seit langem - und es wird weiter polemisiert - über den Begriff "Österreichische Literatur". Meines Erachtens muß schon in dem Titel der Geschichte klar gemacht werden, von welcher Gemeinschaft die Rede ist. Zum Beispiel wäre für das 19 Jh. folgender Titel geeignet: Literatur–Geschichte der österreichischen Monarchie. Allgemeine Geschichte der Literatur von Österreichs Völkern sollte aus mehreren Teilen mit unterschiedlichen Titeln bestehen, was die verschiedene Formen und Grundlagen der Lebensgemeinschaft zu verschiedenen Zeiten widerspiegeln muß.
Die größten Wahlschwierigkeiten, die sich nicht mehr auf Autoren, sondern auf ganze Nationalliteraturen beziehen, entstehen bei der Verfassung von Lehrbüchern, die bei unseren Universitäten lange Zeit unter dem Titel "Geschichte der ausländischen Literatur"’ bekannt waren. Jetzt heißt der Titel : "Geschichte der Weltliteratur". Es wäre sinnvoll bei der Erarbeitung neuerer Lehrbücher für die Literaturgeschichte die Erfahrungen in positiver und negativer Hinsicht, zu respektieren und einzubeziehen.
Ein gewaltiger Pluspunkt unserer Universitäten ist folgender: Außer Kursen der nationalen Literaturen wird bei den geisteswissenschaftlichen Fakultäten obligatorisch auch ein vierjähriger allgemeiner Kurs der ausländischen Literatur angeboten. Dieser ist durch den systematischen Charakter, der auf Chronologie basiert, gekennzeichnet. Er fängt bei der antiken Literatur an, danach das Mittelalter, die Renaissance, das XVII., XVIII., XIX. Jahrhundert bis zu unseren Tagen. Die Literaturentwicklung wird als unaufhörlicher Prozeß gesehen. Die Einbeziehung der Literaturen verschiedener Nationen erfordert ihre Gegenüberstellung und Aussonderung von gemeinsamen und unterscheidenden Merkmalen, die mit den kulturellen Traditionen und historischen Umständen verbunden sind. Zu klären sind auch die Wechselwirkungen, die jede von ihnen in die allgemeine Entwicklung sowohl der Literatur als auch der Literaturwissenschaft gebracht hat. So legt man ein Fundament , man schafft ein Gerüst, auf dem man in der Zukunft selbständig die Literaturstudien bauen kann, jedes Werk in den nationalen und Weltkontext einordnend. So entsteht der Historismus als methodologisches Prinzip. Solch ein allgemeiner Kurs wurde im Laufe der Jahrzehnte von mehreren Wissenschaftlern und Pädagogen erarbeitet. Es sind Programme und Lehrbücher geschaffen worden, aber meistens nur russischsprachige; in der ukrainischen Sprache wurde, leider, sehr wenig verfaßt. Aber es gibt an unseren Universitäten die Fachleute, die diesen komplizierten Kursinhalt an die Studenten vermitteln können. Die Lehrstühle für Weltliteratur bereiten solche Pädagogen über die Aspirantur vor.
Hierfür wurde ein bestimmter Standard für die Materialauswahl erarbeitet. Als traditionelle Bestandteile für solche Kurse gelten die deutschen, englischen, französischen, amerikanischen (ab dem 19. Jh.) Literaturen und in bestimmten Abschnitten österreichische, italienische, spanische, norwegische, belgische, tschechische, polnische und andere Literaturen. In der Auswertung von Literaturen der XX. Jahrhunderts hat die politische Konjunktur besondere Auswirkung gehabt. Als Beispiel kann die chinesische Literatur gelten, deren Erscheinung und danach Verschwinden in den Lehrbücher durch politische Entscheidungen beeinflußt waren.
Es ist unbestreitbar, daß auf keine einzelne Literatur zu verzichten ist. Ein mangelhaftes Wissen kann manchmal zu einem entstellten Flickwerk führen. Davon wurde ich beim Studium der tschechischen Literatur überzeugt, in der man viel mehr von Wichtigem für die allgemeine Entwicklung finden kann, als dies bisher der Fall war. Dasselbe betrifft auch die österreichische Literatur, die in unseren Lehrbüchern nur mit einzelnen Namen vertreten ist. Aber da der Umfang eines jeden Buches begrenzt ist, sowie die menschlichen Möglichkeiten, bleibt nur der einzige Ausweg, nach neuen methodologischen und technischen Vervollkommnungen zu suchen.
In der westlichen Welt wurden in den meisten Fällen Kurse den wissenschaftlichen Interessen von Spezialisten untergeordnet. Vortragende interessieren sich nicht besonders dafür, ob ihre Kurse sich in die vorigen Abschnitte chronologisch einfügen. Positiv dabei ist die Möglichkeit, in vollem Maße eigene Individualität zu zeigen und das Unterrichtsniveau höher zu machen trägt auch dazu bei, daß jede Hochschule sich von den anderen unterscheidet.
Unsere Fachleute verfügen über eine solche Freiheit nur bei der Planung von Sonderkursen und Sonderseminaren. Aber im allgemeinen Kurs sind sie gezwungen, abgesehen von eigenem wissenschaftlichen Interesse und Geschmack, den Programmen, existierenden Regeln und der chronologischen Reihenfolge sich unterzuordnen. Dasselbe betrifft auch die Lehrbücher aus der Geschichte der Literatur. Bei uns sind sie in großem Maße standardisiert - sowohl nach dem Material als auch nach Methodik und Stil - sehr ideologisiert und einander ähnlich.
Als Nachteil gilt unbestreitbar auch, daß sich bei solchen Unterrichtsforderungen, die wissenschaftliche von der pädagogischen Arbeit absondert, und vieles von dem, was eine Person im wissenschaftlichen Sinne macht, in Monographien und Beiträgen veröffentlicht, wird von ihr in den Vorlesungen und beim Lehrbuchschreiben nicht benutzt.
Es lohnt sich zu überlegen, wie man unseren strengen systematischen Charakter bewahren kann. Das ist notwendig, weil dazu schon das Wort "Geschichte" im Titel uns verpflichtet; aus den erarbeiteten Standards das zu nehmen, was nützlich ist, was die Sache erleichtert, und gleichzeitig die westliche Erfahrung der individuellen wissenschaftlichen Erkundung zu nutzen. Wie kann man das auch dann machen, wenn das Lehrbuch nicht von einer, sondern von mehreren Personen geschrieben wird? Natürlich, bei guten finanziellen Möglichkeiten könnte man nicht nur die zur Zeit vorhandene, sondern eine viel größere Zahl von verschiedenen Lehrbüchern erarbeiten und je nach Bedarf dieses oder jenes auswählen oder miteinander ergänzen.
Im Unterschied zu den wissenschaftlichen Beiträgen, die üblicherweise an Wissenschaftler, die sich für dieses Problem interessieren, adressiert sind, hat die allgemeine Geschichte der Literatur mehreren Adressaten. Das sind Gelehrte, Literaturlehrer mit unterschiedlichem Niveau (von einer Universität bis zu allgemeinen Schulen), die Studenten, Schüler und auch die einfachen Leute, die Informationen über die sie interessierenden Fragen bekommen möchten: über die Epoche, den Schriftsteller, das Werk. Und alle diese Forderungen zu befriedigen, ist nicht leicht.
Es entsteht dann auch die Frage des Stils, seiner Unifizierung oder Ununifizierung bei dieser Polyfunktionalität. Die Person, die eine Information braucht, möchte sie kurz und bündig, konkret, so vollständig wie möglich und ohne überflüssige Worte bekommen. Andere Forderungen hat derjenige, der sich nicht nur für die Fakten interessiert, sondern sich den Schriftsteller als lebendige Person vorstellen möchte. Und derjenige, der ihn als unwiederholbare kreative Persönlichkeit erkennen möchte, braucht die Erklärung anhand der Analyse des künstlerischen Materials mit Textanlagen. Er soll damit sowie die Stimme des Schöpfers als auch die Stimme vom Interpretator hören. Damit soll er lernen, ein Kunstwerk zu lesen und dabei die komplexe Wirkung der Kunst auf die Gefühle, die Emotionen, den Intellekt zu spüren, sodaß intellektuelles und emotionales Gedächtnis zusammenwirken können.
Man kann folgende Funktionen der Literaturgeschichte hervorheben:
1.Informativ–erkennende Funktion.
Das Lehrbuch soll die Information über die Epoche, Literaturrichtung, über den Schriftsteller und sein Werk geben.
2.Theoretisch–erkennende Funktion.
Ein Lehrbuch für die Geschichte der Literatur soll eine feste theoretische Grundlage und terminologische Genauigkeit haben.
3.Ästhetisch–kulturwissenschaftliche Funktion,
die mit dem Hauptziel - dem Erlernen der Literatur als einer Kunstart - verbunden ist. Nicht nur Literatur für die Kenntnisse selbst zu studieren, sondern die Leute zu der großen und reichen Welt der Kunst des Wortes heranziehen, sie mit dem Wunsch, immer tiefer diese Welt zu erkennen, anzustecken. Das verlangt aber die Analyse des Charakteristischen mit dem Eindringen in die Besonderheit des bildhaften Denkens, Weltempfindens und wörtlichen Weltschaffens des Autors, verlangt auch die Aufmerksamkeit bei der Interpretation. Damit ist auch die Funktion des Produzierens von kritischem Denken und der Kreativität verbunden.
4. Erziehungsfunktion,
die auf der Oberfläche liegt, aber bei der Wahl der Materialien, in der Akzentsetzung, in detaillierter Betrachtung von philosophischen und moralischen Fragen, sowie in der sprachlichen Gestaltung präsent ist.
5. Methodologische Funktion:
Dieses Lehrbuch wird von Lektoren und Studenten – evtl. künftigen Lektoren – gelesen. Die Bekanntmachung mit verschiedener Methodik und Formen der Materialdarstellung erscheint als besonders wichtig.
Wenn wir die Multifunktionalität behalten möchten und dabei auch die Möglichkeit an den Forscher weitergeben wollen, eigene Individualität zu zeigen und eigene Methodik zu verwenden und weiterzuleiten, so müssen wir die Idee verlassen, ein Lehrbuch in einem einheitlichen Still zu gestalten.
Damit gehe ich zu meinen konkreten Vorschlägen zu zwei möglichen Varianten der Lehrbuchstruktur über.
ist die traditionelle Struktur des Lehrbuchs "Geschichte der fremden Literatur". Zuerst kommt immer die allgemeine Charakteristik der Epoche und Literaturrichtungen. Weiters folgen die Kapitel, die einzelne Nationalliteraturen beschreiben. Jedes Kapitel beinhaltet eine allgemeine Einleitung und geht später auf die einzelnen Autoren ein. Über die allgemeine Kapitel werde ich später berichten. Jetzt möchte ich die monographischen Teile beschreiben. Das sind die Schaffensporträts von einzelnen Schriftstellern.
Man kann sie aus 4 Teilen bilden, die grafisch bezeichnet sind und sich nach dem Stil und den Sprachmitteln unterscheiden.
1.1. Biographische und bibliographische Information, die nach dem Muster von Enzyklopädieartikeln verfaßt wird (das heißt: mit allen üblichen Abkürzungen und Ziffern).
Sie muß kurz, konkret, vollständig und objektiv sein.
Hier werden die Hauptdaten genannt, zum Beispiel Ereignisse aus dem Leben des Schriftstellers und auch wichtige historische Ereignisse, die auf sein Leben und Schaffen einen großen Einfluß hatten. Die Werke, die er geschrieben hat , müssen hier in chronologischer Ordnung und mit den Gattungsbezeichnungen genannt werden. Ein Teil davon kann im Text erläutert werden, wenn Bedarf zu bestimmten Erklärungen besteht. Der Rest kann in Form von Tabellen und Schemen dargestellt werden. Zum Beispiel sollte für das Schaffen folgende Tabelle verwendet werden.
| Jahr, in dem das Werk geschrieben ist, sozial-historische Bedingungen | Jahre der Ausgabe; der Auflagen |
Titel des Werkes in der Originalsprache und in der Übersetzung | Die Gattung; die Gattungsart |
Thematik, Problematik | Zusätzlich auch: Übersetzungen, Kritik und weitere Spalten. |
Die Tabellen müssen so gestaltet werden, daß es möglich wird, sie horizontal und vertikal zu lesen. Zum Beispiel: Wenn wir vertikal die Gattungsspalte lesen, sehen wir die Gattungssysteme des Autors.
Die Jahresspalte gibt uns einen Überblick über die Intensität seiner Arbeit, über den Rhythmus seines Schaffens und eventuelle Pausen bei ihm oder in der Verlagsarbeit. Thematik und Problematik sagt uns etwas über den Kreis seiner Interessen und Ansichten und gibt uns außerdem das Material zur Erforschung des Charakteristischen in den Titeln seiner Werke sowie andere Möglichkeiten.
Unbedingt sollten ein oder mehrere Porträts aus verschiedenen Lebensperioden des Schriftstellers dazugehören. Hier oder am Ende des Abschnittes über den Schriftsteller lohnt es sich, als Schlußfolgerung noch eine zusammengefaßte Tabelle der Werke hinzuzufügen, aber nicht mehr in chronologischer Reihenfolge, sondern nach den Gattungen und mit der Kennzeichnung von ihrer Bedeutung in der Entwicklung des Gattungssystems einer Literaturrichtung.
Der Charakter von Tabellen und ihren Spalten ist vom Schaffen und der Persönlichkeit des Schriftstellers abhängig. Hier kann man die Verbindung mit den anderen Wissenschaften, Kunstarten hinzufügen, wie zum Beispiel mit der Musik für solche Autoren wie E.T.A. Hoffmann oder H. Broch; weitere Spalten für Übersetzungen, literaturwissenschaftliche Schriften usw. wären auch möglich.
Die Darstellung des Teiles 1.1 muß konkret, kompakt und objektiv sein.
1.2 Der Hauptteil
Das Vorhandensein von Teil 1.1 erlaubt dem Forscher, sich wählerischer und freier zu den einzelnen historischen oder biographischen Fakten zuzuwenden, die mit dem Schaffen des Schriftstellers oder mit dem Literaturprozeß verbunden sind. Damit die Epoche und der Künstler in ihr lebendig werden, kann man hier die entsprechenden Anekdoten beschreiben. Daneben sollten Photos, Groteskezeichnungen und Karikaturen eingeführt werden. Mit Hilfe des Computers können die Porträts teilweise gezeigt werden. Zum Beispiel die strahlenden Augen von F. Stendal oder die Kontrastwirkung vom oberen und unteren Teil des Gesichtes von E.T.A. Hoffmann.
So sehr man in Teil 1.1 Objektivität und Streben nach maximaler Vollkommenheit braucht, so sehr ist im Teil 1.2 die Möglichkeit einer freien Auswahl vorhanden, um eigene Betrachtungsweisen und Methodik in der Analyse der künstlerischen Erscheinungen anzuwenden.
Zum Beispiel beschäftige ich mich seit mehreren Jahren mit den Fragen der Gattung und des Zeit-Raumes in der Literatur und ihren Wechselwirkungen. Ich habe entsprechende Seminare und Schemen erarbeitet; manche sind publiziert worden.(1) Deshalb würde ich Inhalt, Philosophie, Besonderheit der Struktur des Werkes, seines Stils eben anhand der komplexen Analyse der Gattungs- und Zeit-Raum-Besonderheit darstellen.
Jemand anderer, der sich mit den anderen theoretischen Fragen beschäftigt, wird eine neue Betrachtungsweise eröffnen, was uns dann erlaubt, das Werk und den Autor in einer vielleicht ungewöhnlichen Verkürzung und neuen Beziehungen zu sehen.
Aber an eine Regel muß man sich halten. Und zwar: von der allgemeinen Charakteristik soll unbedingt etwas Besonderes gewählt werden – ein Werk, mehrere oder ein Teil eines Werks oder ein roter Faden – und es als eine Großaufnahme darzustellen, mit den tieferer Analyse und Aufmerksamkeit für ein Bild, ein Wort, eine Intonation usw. Nur so kann man den Platz eines Schriftstellers im Literaturprozeß zeigen und den Lernenden Hinweise in dieser Hinsicht geben.
Im Unterschied zu den wissenschaftlichen Beiträgen berufen sich die Lehrbuchautoren selten auf ihre Vorgänger in der Forschung von bestimmten Erscheinungen, selten führen sie Polemik mit den anderen Gelehrten. Deshalb stellen sie ihre Meinung als einzig mögliche dar, und zwar das Komplizierte als Einfaches, das Bestrittene und Problematische als Gelöstes. Natürlich hat die Gattung eines Lehrbuches ihre Besonderheiten und Beschränkungen, trotzdem ist auch bestimmtes informatives Material notwendig. Dieses kann man in den Teilen 1.3 und 1.4 in vollerem Maße darbieten.
1.3. Information über die Rezeption der Werke des Schriftstellers
im Land, für das dieses Lehrbuch in erster Linie bestimmt ist. Als Beispiel solcher Materialdarlegung kann die von J. Fischer in Prag herausgegebene Geschichte der französischen Literatur dienen.
1.4. Bibliographie
Die Arbeiten über den Schriftsteller.
Es ist auch möglich die Teile 1.3 und 1.4. zu vereinigen und sie in Tabellen, Diagrammen, Schemata, Zeichnungen darzustellen.
2. Variante der Lehrbuchstruktur
Das Lehrbuch besteht aus einzelnen Abschnitten, die die Perioden, Literaturströmungen und Literaturrichtungen charakterisieren. Anstelle von Miniaturporträts der Schriftsteller schließt es kleinere Abschnitte ein, die der Entwicklung von verschiedenen Genres und Genreabarten gewidmet sind, die im Genresystem dieser Richtung oder Periode dominieren. Es ist zweckmäßig, jeden von diesen allgemeinen Abschnitten in der Variante 1 und 2 aus einigen graphischen Teilen zu strukturieren. Die zusammengestellte Tabelle von historischen Ereignissen am Abschnittsanfang enthebt von der Notwendigkeit diese Ereignisse im Textteil zu charakterisieren und gibt die Möglichkeit, sich auf den Zusammenhang des Wandels in der Gesellschaft und Kultur zu konzentrieren. Die Aufzählung von Richtungsvertretern mit ihren Lebensdatenangaben, die Tabelle des Genresystems dieser Richtung kann getrennt angeboten werden, aber sie kann auch zu einem Simultan komplizierter Schemata vereinigt werden. Zum Lehrbuch in der Variante 2 ist es notwendig, in speziellen Ergänzungen mehr Information über Schriftsteller, die im Text erwähnt sind, hinzufügen - am besten in alphabetischer Reihenfolge, was die Benutzung erleichtert, und nach jenen Prinzipien, die oben in 1.1., 1.3., 1.4. dargelegt wurden.
Jeder Autor darf den Textteil nach seinem Wunsch bilden, je nach seinen Kenntnissen und Interessen. Der eine wird tiefer die Wechselwirkungen zwischen der Kunst und den Wissenschaften zeigen, der andere zwischen den einzelnen Kunstarten, der dritte wird sich auf die soziologische und psychologische Analyse der Veränderungen in der Konzeption des Menschen und des Künstlers konzentrieren.
In der Struktur Variante 1 entstanden Probleme mit den Schriftstellern, die zu verschiedenen Literaturperioden gehörten. Manchmal wurde ihr Schaffen geteilt, wie es z.B. in der akademischen Geschichte der deutschen Literatur gemacht wurde, wo eine Periode des Schaffens von Heinrich und Thomas Mann im 4. Band betrachtet wird, und die andere im 5. Band , was sich vom Standpunkt der Periodencharakteristik als richtig erweist, aber die monographische Ganzheit des Schriftstellerporträts zerstört. In der Struktur Variante 2, die dem XX. Jahrhundert am besten angepaßt ist, aber auch für die Literaturgeschichte der früheren und alten Perioden geeignet ist, existiert dieses Problem nicht.(2)
Bei der Charakterisierung der Literaturrichtung ist es notwendig den Kernpunkt zu bestimmen, der das ganze Material organisiert. Wenn man die Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen den Erscheinungen oder das Neue, das mit einer Richtung in die Literatur eindringt, zeigt, wenn man mit dem, was schon allgemeingültig, kanonisiert oder sogar zum Klischee geworden ist, und deshalb die weitere Entwicklung bremst, polemisiert, spielt das Genresystem die Rolle eines solchen Kernpunktes hervorragend. Die Entstehung jedes neuen Genres, jeder Abart oder Modifikation, widerspiegelt gewisse Gesetzmäßigkeiten der allgemeinen Gesellschaftsentwicklung, gesellschaftliche, ästhetische, moralische Forderungen, den Stand der Wissenschaft und Philosophie, Geschmack und Interessen der Menschen, ihre Einstellung zur Kunst und zur Kultur. Gleichzeitig wirken hier die inneren Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung der Redekunst.
Gestatten Sie mir einen kleinen Rückblick auf meine Erarbeitungen der Begriffsfrage "Genre", "Genresystem". Sie sind in meinen Publikationen zusammengefaßt(3), aber jetzt brauche ich daraus nur das, was die Struktur der Lehrbuchabschnitte über die Literaturepochen betrifft. Der Begriff "Genresystem" ( wie auch der Begriff "Genre") ist mehrdeutig. In diesem Begriff kann man unter Vorbehalt 4 Sphären sondern, die ineinander einfließen.
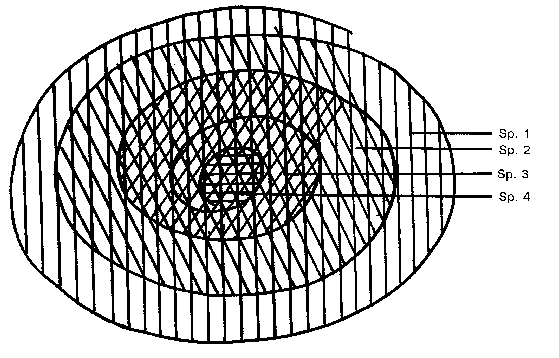
Sphäre 1
Genresystem der gesamten Literatur als einer Kunstart. Hierher gehören alle Genres,
Abarten, Modifikationen, die irgendwann oder irgendwo entstehen. Das ist das System der
Systeme.
Sphäre 2
Das Genresystem einer Literaturepoche, einer Richtung.
Jede neue Etappe der Literaturentwicklung ist ihre Fortsetzung und Opposition zu den
unmittelbaren Vorgängern.
Es entstehen neue Genreabarten , und es wird eine neue Genre–Hierarchie gegründet.
Sphäre 3
Das Genresystem der Literaturepoche, der Nationalliteraturrichtung mit ihrer Spezifika.
Sphäre 4
Genresystem des Schaffens eines einzelnen Schriftstellers.
Indem wir diese Spirale benutzen, erweitern wir in einer Richtung den Begriff: wir schließen die Sphäre 4 (das Genresystems des Schriftstellers) in das Nationalgenresystem der Literaturrichtung (Sphäre 3) ein, dann in die allgemeine Charakteristik der Literaturrichtung (Sphäre 2) und endlich in das ganze Genresystem der Literatur (Sphäre 1).
In anderer Richtung verengen wir den Begriff und konkretisieren ihn: von der Sp.1, dem Genresystem der ganzen Literatur, die sich immer nur bereichert, gehen wir zu der Sp.2 über, dem Genresystem der historischen Periode, wenn Genre–Zunahme und Abnahme stattfinden und auch der Dominantenwechsel. Von der allgemeinen Charakteristik der Richtung gehen wir zu ihrer Nationaleigenartigkeit über (Sp.3), wenn wir ihre Beziehungen zu den Sp.2 und 1 bewerten, und dann zur Sp.4, dem Genresystem des Schriftstellers, seiner Individualität.
Es ist hier sehr wichtig, jedes Mal nicht nur das an den Tag zu bringen, was zur Literatur gehört, sondern auch das, was sich auf die Literaturwissenschaft bezieht: die Ansätze der literaturwissenschaftlichen Schulen, Tendenzen. Ich bin überzeugt, das die Wurzeln der literaturwissenschaftlichen Schulen des XX .Jahrhunderts bereits in der Epoche des Romantismus zu finden sind. Die Periodisierung des Literaturprozesses ist eine sehr komplizierte Frage, die eine spezielle Betrachtung verdient. Die Zusammenstellung der Periodisierung führt unvermeidlich zu einer gewissen Vereinfachung. Deshalb braucht man hier verschiedene graphische Zeichnungen, die darauf abzielen, besser zu begreifen, daß die Richtungen nicht einfach einander ersetzen, sondern zusammenwirken und koexistieren, manchmal neu entstehen. Die Entstehung einer neuen Richtung bedeutet manchmal Gewinn, manchmal Verlust, aber es ist immer der Ruf ihrer Zeit.
Erbfolge ist ein komplizierter Prozeß - die Künstler wenden sich in der Regel an entfernte Traditionen: Symbolisten an den Romantismus, die Expressionisten an das Barock und so weiter.
In der Strukturvariante 2 kann ein und derselbe Schriftsteller in mehreren Abschnitten erwähnt und analysiert werden, sein Schaffen muß nicht unbedingt in eine Bahn hineingedrängt werden, wenn er in verschiedenen Zeitperioden seines Lebens oder sogar gleichzeitig zu mehreren Richtungen gehört hat, und wenn an seinen Werken das Charakteristische für verschiedene Richtungen zu zeigen ist, wie z.B. an den Werken von Kafka — Expressionismus, formale surrealistische Züge, philosophische Kodes des Existenzialismus.
Richtung, Strömung entstehen entweder gleichzeitig in verschiedenen Kunstarten, wie Romantismus, oder konstituieren sich in einer Art, wie Impressionismus in der Malerei, und werden dann von anderen Kunstarten übernommen. Manchmal ist es leichter, die Entstehung einer Literaturerscheinung auf Grund der Malerei oder Musikwerke zu erklären. Deshalb ist es sehr wichtig, im Lehrbuch Abbildungen zu haben , aber da nur die qualitativen farbigen Reproduktionen die ästhetische, erzieherische, intellektuelle Funktionen ausüben, verlangt das Zusatzkosten. Zur Literaturgeschichte ist es nützlich, noch weitere Materialien hinzuzufügen; und zwar: methodische und methodologische Anweisungen der Analyse des schöngeistigen Textes, der Werke einer anderen Kunstart, z.B. zum Romantismus Gemälde von Geriko oder Friedrich, zum Expressionismus Werke von Munk oder Barlach, die Interpretation der musikalischen Werke, verschiedene Tabellen, Schemen, die die synchrone Entstehung der Werke der Literatur und anderer Kunstarten, wissenschaftlicher, philosophischer Arbeiten widerspiegeln. Alle diese Materialien sollten als thematische, methodische Beitrage zu den Abschnitten gelten, aber sie könnten auch selbständig verwendet werden. Hier könnten auch verschiedene literarische Spiele, Vorschläge zur Spielinterpretation, nicht traditionelle Methoden des Literaturstudiums vorgeschlagen werden.
© Nonna Kopystianska (Lviv)
(1) N. Kopystianska: Künstlerische Zeit als Kategorie der
Vergleichspoetik. Slavische Literaturen. Materialien zu der 11. Tagung von Slavisten.
K.1993, S.184-200.
N. Kopystianska: Chronotop als Aspekte des Studiums der Genresystem von Romantismus.
Zagadniena rodzajýw iterackich 37. H.2, 1994 , S.119-135.
N. Kopystianska: Die Aspekte von der Funktion des Raumes, die räumliche Details in einem
schöngeistigen Werk. Almanach Die neue Nation 5, K. 1997. S.172-178.
N. Kopystianska: Die Besonderheiten des sozial-historischen Chronotops in den Romanen von
F. Kafka "Der Prozeß" und "Der Schloß". Ausländische Philologie.
H.111, 1997, S.158-167.
(2) Geschichte der deutschen Literatur. 4.Band, M., "Nauka", 1968; 5. Band M., 1976.
(3) N. Kopystianska: Genremodifikationen in der
tschechischen Literatur. Lviv, Universitätsverlag, 1978.
N. Kopystianska: Der Begriff "Genre" in seiner Stabilität und
Veränderlichkeit. Kontext 1986.M."Nauka", 1987, S. 132-153
N. Kopystianska: Zu der Frage über Funktionalität von Begriffen "Genre",
"Genresystem". Litteraria humanitas. Genologiské studie I. Brno (Masarykowa
universita v Brne, fakulta filosoficke) 1991, S. 37-46.
N. Kopystianska: Die Aspekten der Studien von Genre und Genresystemen. Litteraria
humanitas. Genologiské studie II.Brno 1993, S. 73-78.
N. Kopystianska: Zu der Frage über den systematischen Charakter beim Erlernen des Genres.
Zagadniena rodzajýw iterackich 36, H.1-2 (71-72) 1993, S.97-111.
Webmeisterin: Angelika Czipin
last change 19.11.1999